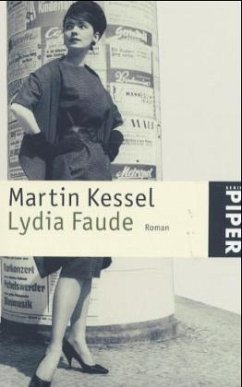Aber die Hoffnungen zerplatzen, weil das Erbe - die Confiserie Morawe am Kurfürstendamm - nurmehr ein Mythos seiner selbst ist, überaltert und abbruchreif. An seinen traditionsreichen Namen, an die Aussicht auf die Erbschaft knüpfen sich Gier und Habsucht, Spekulation und kühne Pläne, Betrug und Kriminalität. Eine in jeder Hinsicht bunte Gesellschaft kommt zusammen, Intrigen werden gesponnen, jeder versucht, für sich selbst das Beste herauszuholen.
Kessels großartiger Roman über das Berlin der frühen sechziger Jahre ist turbulent und temperamentvoll, witzig und zeitkritisch: ein großes Lesevergnügen.
Kessels großartiger Roman über das Berlin der frühen sechziger Jahre ist turbulent und temperamentvoll, witzig und zeitkritisch: ein großes Lesevergnügen.

Martin Kessel wird nie die Aspasia spielen / Von Heinz Ludwig Arnold
Der Schriftsteller Martin Kessel (1901 bis 1990) ist nie wirklich berühmt geworden, obwohl er 1926, nach nur zwei Gedichtbänden, bereits mit dem Kleist-Preis und 1954 für sein Gesamtwerk mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet wurde. Das mag auch daran liegen, daß dem Zweiunddreißigjährigen die produktivste Zeit seines Lebens geraubt wurde. Denn wenige Monate nachdem Kessel seinen ersten großen Roman "Herrn Brechers Fiasko" herausbrachte, das inzwischen wieder einigermaßen bekannt gewordene neusachliche Berliner Binnenpanorama der Kracauerschen Angestelltenwelt, marschierte Deutschland ins "Dritte Reich". Von ihm hat sich Kessel entschieden ferngehalten, obgleich er im Lande geblieben ist. Wie fern er dem braunen Terror stand, läßt sich seinem schmalen Roman "Die Schwester des Don Quijote" ablesen: ein bekenntnishafter Rückzug aus dem vergifteten Leben in die exterritoriale, weil längst vertriebene Kunst, die den Wahnwitz der Zeit nicht verschleierte, sondern aus autonomer Perspektive wahrnahm und erkennend durchdrang.
Das war die Reaktion eines hochgebildeten Einzelgängers. Kessel, der Germanistik, Philosophie, Musik- und Kunstwissenschaft studiert hatte und über Thomas Manns Novellentechnik promoviert wurde, versuchte sich auf fast allen literarischen Terrains: Er schrieb in den zwanziger Jahren Gedichte, Novellen, ein Lustspiel und ebenden Roman "Herrn Brechers Fiasko", und nach 1933, als ihm der Atem einer freien Autorschaft genommen war, kultivierte er die kurze pointierende Form. Viele Hunderte Aphorismen entstanden, die erstmals 1948 und dann immer wieder in kleinen Sammlungen erschienen sind. Einer dieser Sammlungen, "Gegengabe" von 1960, entnahm Kessel denn auch das Motto, das er seinem zweiten großen Roman "Lydia Faude" von 1965 voranstellte: "Jeder Mensch wird als Zwilling geboren: als der, der er ist, und als der, für den er sich hält."
Lydia Faude, seine Protagonistin, hält sich allerdings für mehr, als sie tatsächlich ist. Ihr Bewußtsein wird bestimmt von der Ausmalung ihrer Wunschphantasien und der stets nur positiven Aufladung künftiger Möglichkeiten - die in ihrem Falle aber alle ins Negative drehen.
Bei solcher Disposition liegt es fast zu nahe, daß Kessel diese Lydia Faude als Schauspielerin ersonnen hat - als Illusionistin, die zwischen Sein und Schein freilich nicht unterscheiden mag. Zwar hat sie nur zweimal kurz an Provinzbühnen eher Nebenrollen gegeben, aber sie geriert sich als Star und lebt, auf deren Kosten, bei ihrer Schwester Alice, die sich mit Schneiderarbeiten durchbringt.
Lydias Lebenstraum ist es, die Aspasia zu geben, ja Aspasia zu sein; die antike Hetäre wurde im Athen des Sokrates von allen Männern wegen ihrer Anmut und ihrer geistreichen Unterhaltungen bewundert, ihretwegen trennte sich Perikles, der "Mann des Jahrhunderts", von seiner Frau. So möchte auch Lydia sein, und zwar umfassend: auf der Bühne, im Film und im Leben.
Dazu fehlt nur noch der monetäre Unterbau. Den scheint sie in die Hand zu bekommen, als ihre Mutter ihr die Vollmacht in einer Erbschaftsangelegenheit erteilt: das berühmte Süßwarengeschäft Morawé am Kurfürstendamm soll nach dem Tode seines Eigentümers verteilt werden.
Auf dieser Vollmacht, die Lydia bereits für bare Münze nimmt, errichtet sie ihr Wolkenkuckucksheim: Der muffig quere Schriftsteller Schreieck soll ein Aspasia-Stück für sie entwerfen, eine Aspasia-Filmgesellschaft wird gegründet, und Alice näht der Schwester schon einmal ein prächtiges Aspasia-Kostüm. Das erweist sich schließlich als das einzig Handfeste in dieser Geschichte. Am Ende nämlich wird Alice am Kurfürstendamm ein Modeatelier einrichten, das ihr ein solider Geschäftsmann finanziert, der am Aspasia-Kostüm erkannt hat, daß Alice eine vorzügliche Modistin ist.
Und Lydia? Ihre Träume lösen sich nacheinander in teure Illusionen auf. Ihr Anwalt erleidet einen Schlaganfall, das berühmte Süßwarengeschäft Morawé entpuppt sich als Umschlagsort für Drogen, und seine Verwalter haben sich längst mit allem Geld aus dem Staube gemacht. Auch Alfredo ten Dam, Lydias "Mann des Jahrhunderts", der einzige, dem sie sich hingeben mochte und der nun als Schmuggler und Dealer gesucht wird.
Das alles ist der Stoff für eine deftige Kolportage. Doch Kessel ist kein Autor dafür. Und so ist dieser über fünfhundert Seiten dicke Roman weder eine Kolportage geworden noch ein Zeitroman. Und schon gar nicht ein Berlin-Roman, als der dieses Buch firmiert.
Daß es zu keiner spannenden Zeitkolportage reichte, muß kein Nachteil sein. Aber einen spannenden Roman hätte man schon gern gelesen. Doch dazu gehören außer verschränkten Erzählbögen, Motiven und Spannungselementen vor allem Wirklichkeitsfarben. Die aber sind leider überaus spärlich - Kessel, das spürt man auf fast jeder Seite, schreibt zu gebildet, zu gewunden, bleibt oft abstrakt; dem Aphoristiker gerät sein Erzählstoff immer etwas zu breit und deshalb zu dünn und fast immer zu allgemein; die Charakterisierungen seines Personals mißraten zwar nicht zu Klischees, fallen aber dennoch allzu stereotyp aus.
Witzig immerhin sind manche Dialoge, aber auch sie leben eher vom Sprachwitz als von entwickelten Situationen - überhaupt fehlt dem Roman die Romanwelt; weder Orte noch Räume werden anschaulich, und viele Figuren bleiben reiner Wortzunder. Auch Berlin spielt in diesem Roman so gut wie keine Rolle, die irgend nachempfunden werden könnte. Und wenn das Süßwarengeschäft Morawé an der Kö läge statt am Kurfürstendamm, könnte das Ganze auch in Düsseldorf spielen.
Natürlich ahnt man, daß Kessel mit diesem Roman den fünfziger Jahren ein kritisches Memorial errichten wollte: als Darstellung des Doppellebens und der Lüge, innerer Leere und äußerer Hybris. Aber seine Figuren agieren nicht auf einer Zeitbühne, sondern allenfalls wie in einem Kammerspiel. So wie von Berlin kaum etwas zu spüren ist, erfährt der Leser auch so gut wie nichts über den geschichtlichen Raum und das gesellschaftliche Ambiente, in denen sich die Figuren des Romans bewegen. Da steht kein Wort über die Teilung Deutschlands, die doch das Berlin der fünfziger Jahre bestimmte; nicht ein Wort über die Vergangenheit dieser Stadt, in deren Konsequenz sie sich damals entwickelte. Politik findet da nicht statt, aber auch nicht Geschichte, nicht Gesellschaft. Wenn aber von Politik doch einmal die Rede ist, geschieht dies nicht konkret, sondern bloß räsonierend, in aphoristischer Überspitzung und Verallgemeinerung: "Sie habe doch sicherlich auch schon bemerkt, daß alles, was die Politik anrichte, im Endergebnis - es gebe ja auch ein Zwischenergebnis und eigentlich gebe es immer nur das - indiskutabel sei, weil es lediglich auf eine Verschleierung der wahren Interessen hinauslaufe." Das hätte man doch gern etwas konkreter.
Man muß nicht für eine Politisierung von Literatur plädieren, um vom gesellschaftlichen Ort des Erzählten in einem solchen Roman etwas erfahren zu wollen. Statt dessen hat man beim Einstieg in dieses Buch lange Zeit nicht nur den Eindruck, der Roman könne sogar in den zwanziger Jahren spielen. Außer jeglichem Lokalkolorit fehlen auch die Farben der Zeit.
Nun könnten diese Farben ja in Sprachgesten und Tönungen sich vermitteln. Aber auch das tun sie nicht. Kessel vermittelt nicht, sondern beschreibt, er steckt als Erzähler nicht in seinen Figuren, sondern hantiert mit ihnen wie mit Marionetten; er steht, wenn er sie erzählt, neben ihnen - noch dann, wo so etwas wie Lust beschrieben wird, in der sexuellen Begegnung Lydias mit Alfredo ten Dam: "In Wirklichkeit, wenn er den Arm um sie legte oder sie um die Hüfte nahm, was er mit Vorliebe tat, war jedoch ein aufwärts strebendes Zittern in ihr, beschattet von einer dunklen Erwartung. Es war etwas Fremd-Vertrautes, das fortwährend in Bewegung schien, das sich fortpflanzte bis ins Verlangen, und es war auch ein Wohlgefühl in der Haut, eine knisternde Alchimie, und oft sogar eine Art Narrheit im Blick, was alles ihr ein Gefühl eingab, als ob sie, nicht recht bei Sinnen, nur so dahintrieb, nahezu ohne Zeitgefühl. Sie spürte den Anhauch seiner Nähe, sie konnte nicht von ihm lassen, und sie konnte sich auch nicht satt sehen an der Eigenart seiner Gestalt, wie überhaupt am Ausdruck seiner Bewegungen, seiner zufällig hingeworfenen Gesten, und so war sie auch entzückt vom Klang seiner Worte, mochte er sagen was immer."
Daß in diesem Roman vieles nur abgehandelt und nur wenig wirklich erzählt wird, liegt nicht an der Entstehungszeit des Werks. Es liegt an Kessels literarischer Disposition. Er hat sich zwar an Thomas Manns Erzählkunst geschult - und man spürt unentwegt die Bemühung, es ihm gleichzutun -, auch fehlen ihm weder Intellektualität noch Bildung. Er hat vielleicht im Gegenteil davon fürs Erzählen zuviel, und leider will er es auch zeigen. Was Martin Kessel fehlt, ist das erzählerische Temperament. Denn wo alles, was mitzuteilen ist, hin und her gewendet wird, bleibt kein Raum mehr für unvorhersehbare Entwicklungen; und wo der Aphoristiker, der Kessel genuin ist, in seiner Sprache auf die Pointe und zugleich auf allgemeine Gültigkeit setzt, kann sich erzählerische Subjektivität nicht entfalten.
Deshalb gibt es in diesem Buch viele Pointen und kluge Anmerkungen en passant, es gibt interessante Erkenntnisse über Gott und die Welt, und es gibt witzige Dialoge; und man nimmt an einigen Figuren auch karikierende Aspekte wahr. Einmal räsoniert der Erzähler sogar über die zeitgenössische Literatur, läßt Lydia klagen, daß die Romane der Saison sie nicht wirklich befriedigt hätten, zumal dort, "wo sich die Spuren ins Labyrinth der Erotik verliefen. Nicht nur, daß dort keinerlei Delikatesse herrschte, auch das schlechthin Animalische und Sexuelle, auch der orgiastische Trieb manifestierten sich in einer Art, die im Grunde belächelnswert war, weil es auf kindischste Weise an zur Schau gestellt Pubertätsgelüste gemahnte. Diese Herrschaften manipulierten an ihren Extremitäten herum wie ein Tankstellenbesitzer an seinem Benzin, und dann spritzte eben der Saft."
So sehr wie in den da kritisierten Romanen hat sich Kessel nicht in die Niederungen des Erzählens hinabbegeben. Nur einmal, ganz am Schluß, als auf Lydias neues erotisches Verhältnis mit dem Maler Mumprich angespielt wird, muß man lesen: "Vielleicht hatte sie ihn sogar eingeführt in die Schamteile ihrer untersten Lippen."Der Satz zeigt nun doch exemplarisch, wie sehr Martin Kessel mit seinem Roman "Lydia Faude" neben das Erzählen geraten ist.
Martin Kessel: "Lydia Faude". Roman. Schöffling Verlag, Frankfurt am Main 2001. 540 S., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Der enorm stilsichere Fabulierer Martin Kessel entwirft ein Szenario von hinreißender Geschwätzigkeit, in der die Protagonisten mit großer Geste und glühendem Welterneuerungspathos schwadronieren. Triefend von Spott werden Frauenträume ins Groteske verzerrt." (Nürnberger Nachrichten)