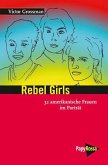Lynchjustiz ist ein Begriff, der bis heute mit Rassismus, Terror und Gewalt, mit dem berüchtigten Ku-Klux-Klan und dem amerikanischen Süden verbunden ist; ein Verbrechen, das Zehntausende Menschen das Leben kostete.
Manfred Berg erzählt die Geschichte der Lynchjustiz gegen schwarze Amerikaner, Mexikaner oder Chinesen von ihren Anfängen in der Kolonialzeit bis in die Gegenwart. Er berichtet vom Widerstand gegen die Lynchjustiz und untersucht, warum sie um die Mitte des 20. Jahrhunderts aufhörte und welches Erbe sie in der amerikanischen Kultur hinterlassen hat.
Wer verstehen will, warum das staatliche Gewaltmonopol in den USA eine vergleichsweise geringe Akzeptanz findet und die USA die drakonischste Strafjustiz der westlichen Welt praktizieren, findet in diesem Buch Antworten. Dabei beleuchtet Manfred Berg auch, welche Kontinuitäten zwischen dem Lynchen und der Todesstrafe bestehen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Manfred Berg erzählt die Geschichte der Lynchjustiz gegen schwarze Amerikaner, Mexikaner oder Chinesen von ihren Anfängen in der Kolonialzeit bis in die Gegenwart. Er berichtet vom Widerstand gegen die Lynchjustiz und untersucht, warum sie um die Mitte des 20. Jahrhunderts aufhörte und welches Erbe sie in der amerikanischen Kultur hinterlassen hat.
Wer verstehen will, warum das staatliche Gewaltmonopol in den USA eine vergleichsweise geringe Akzeptanz findet und die USA die drakonischste Strafjustiz der westlichen Welt praktizieren, findet in diesem Buch Antworten. Dabei beleuchtet Manfred Berg auch, welche Kontinuitäten zwischen dem Lynchen und der Todesstrafe bestehen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Prägungen von langer Dauer: Manfred Berg erzählt die Geschichte der Lynchjustiz in Amerika
Abraham Lincoln, damals ein junger Anwalt und Politiker in Illinois, kritisierte 1838 in einer Rede den "mobokratischen Geist" in Amerika. Das empörte Volk, das als Mob das Gesetz in die eigene Hand nahm, war laut Lincoln ein landesweites Phänomen, und "Berichte über die von Mobs verübten Schandtaten" waren "alltägliche Nachrichten". Lincoln nannte drei Fälle von Hinrichtungen durch Mobs. In Vicksburg, Mississippi, waren fünf Glücksspieler gehängt worden. So erging es in diesem Staat auch Sklaven, die einen Aufstand geplant haben sollen, und Weißen als ihren angeblichen Anstiftern. In St. Louis, Missouri, rächte ein Mob den Tod eines Hilfssheriffs und verbrannte den Täter, einen freien Mulatten, bei lebendigem Leib.
Was Lincoln als Mobgewalt ablehnte, war nach dem Selbstverständnis der Akteure allerdings eine gerechtfertigte Form des gemeinschaftlichen Schutzes vor Verbrechern. Die Lynchjustiz sollte Recht und Ordnung wahren, "wenn und solange die Staatsgewalt dazu nicht bereit oder in der Lage ist", schreibt Manfred Berg in seiner Geschichte der Lynchjustiz in Amerika. Der Heidelberger Historiker hat eine faktenreiche Gesamtdarstellung verfasst. Die Einzelanalyse von Lynchmorden und ihrer Legitimierung verknüpft er souverän mit Prägungen von langer Dauer, denn das kulturelle Erbe der Lynchjustiz reiche bis in die Gegenwart, so Berg, "auch wenn dies in der amerikanischen Öffentlichkeit nur selten anerkannt wird".
Dass die Verteidiger der Lynchjustiz sich auf ein Mitwirkungsrecht des Volks beriefen, führt Berg auf die Kolonialzeit zurück. Wehrfähigen Männern oblag es, als "Posse" (Hilfstrupp) den Sheriff zu unterstützen. Hinrichtungen fanden öffentlich statt. Verbrecher sollten vor der Gemeinschaft ihre Schuld gestehen, die Zuschauer zeigten ihre Zustimmung zur Strafe - und bisweilen deren Erlass, wenn es zu einem Gnadenakt in letzter Minute kam. Im Konflikt der Kolonien mit dem Mutterland vollzogen patriotische Mobs an Zollbeamten und anderen Vertretern der Kolonialpolitik das Strafritual des Teerens und Federns. Nachdem der Unabhängigkeitskrieg ausgebrochen war, griffen Colonel Charles Lynch und andere Milizoberste in Virginia zu Ad-hoc-Tribunalen, um gegen Verräter und Verbrecher vorzugehen. In einem Brief sprach Lynch selbst von "Lynchs Gesetz".
Als die Bürger von Vicksburg im Juli 1835 die weißen Spieler lynchten, äußerten zwar viele Zeitgenossen Lincolns ebenfalls Kritik an Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren. Besonders im Süden galt solch vehementes Handeln aber als beispielhaft. Dort war die Lynchjustiz eng mit der Sklaverei verbunden, und wie in dem von Lincoln zitierten Fall löste die Furcht vor Aufständen etliche Lynchmorde aus. Gewalt gegen Schwarze kannte keine Grenzen. Durch den dreizehnten Verfassungszusatz wurde die Sklaverei nach dem Bürgerkrieg abgeschafft; die Lynchjustiz trug jedoch dazu bei, die weiße Vorherrschaft weiter zu sichern.
Über die enge Verbindung mit der Sklaverei und der Rassenfrage im Süden hinaus folgt Berg einem zweiten Traditionsstrang der Lynchjustiz an der "Frontier", der westwärts wandernden Siedlungsgrenze. Das Lynchrisiko für Mexikaner im Südwesten lag ähnlich hoch wie das für Schwarze im Süden. Berg betont, dass Lynchmobs auch an der "Frontier" ihre Opfer oft erst aus einem Gefängnis befreiten, obwohl doch die Abwesenheit staatlicher Justiz das Lynchen notwendig gemacht haben solle.
Fast drei Viertel der Opfer waren Afroamerikaner - bezogen auf 4716 Lynchmorde, die "nach konservativen Schätzungen" zwischen 1882 und 1946 geschahen. Vor manchmal Hunderten oder Tausenden Zuschauern hielten die Lyncher ihre Rituale der Gewalt als Massenspektakel ab. Die Opfer wurden verstümmelt und verbrannt, Leichenteile waren Trophäen, Fotografien dokumentierten den Stolz der Täter. Ein zentrales Motiv zur Legitimierung der Gewalt war der Schutz weißer Frauen vor vermeintlichen Vergewaltigern. Berg legt die perfide Logik offen, mit der dabei die Schwarzen gleich doppelt für das Lynchen verantwortlich gemacht wurden: Wie nämlich der einzelne schwarze Mann an der Kontrolle seiner Lust scheitere, so scheitere auch die schwarze Gemeinschaft als Ganze an der Kontrolle ihrer potentiellen Triebtäter.
Der amerikanische Senat bekannte in einer Entschuldigungsresolution vom 13. Juni 2005 sein historisches Versagen, nie ein Gesetz gegen das Lynchen beschlossen zu haben. Während der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts sank die Zahl der Lynchmorde aber auch ohne ein Bundesgesetz. Für die Selbstverteidigung der Afroamerikaner gegen Mobgewalt bringt Berg ebenso Beispiele wie für das Engagement der "National Association for the Advancement of Colored People" (NAACP) und anderer Reformgruppen. Doch vor allem verweist er darauf, dass das Ende der Lynchjustiz "mit einer drastischen Ausweitung der staatlich exekutierten Todesstrafe einherging".
THORSTEN GRÄBE.
Manfred Berg: "Lynchjustiz in den USA". Hamburger Edition, Hamburg 2014. 275 S., Abb., geb., 32,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Rudolf Walther beschränkt sich in seiner Besprechung dieses Buch fast völlig auf die Nacherzählung des Inhalts. Manfred Bergs Definition des Lynchmord findet dabei ebenso seine Zustimmung, wie die Geschichte von der Kolonialzeit über die Sklavenhaltung bis in die heutige Zeit sein Entsetzen erregt. Berg analysiere die kulturellen Bedingungen vor allem der Südstaaten, unter denen es möglich war, dass tausende von Menschen, unter Missachtung eines an sich schon drakonischen Rechtssystems, spontaner Selbstjustiz zum Opfer fielen, fasst der Rezensent zusammen, der von Bergs genauen Ausführungen gleichermaßen bestürzt und beeindruckt ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH