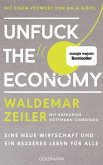"... Wer eine aufgeklärte Analyse des sowjetischen Wirtschaftssystems sucht, stößt hier auf eine wahre Goldgrube. Von der Steigerung der Sparquote und der Investitionen durch Konfiskation, der Ankurbelung der Arbeitsmotivation durch progressive Stücklöhne und leistungsabhängige Steuerdiskriminierung bis hin zur Einrichtung eines Systems gegenseitiger Kontrolle der Untergebenen - Olson verdeutlicht die ganze wohlüberlegte "brutale und listige Innovation" stalinistischer Wirtschaftspolitik ...." Karen Horn in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17. März 2003, S. 12

Warum eine Diktatur auch keine vernünftige Übergangslösung bietet
Mancur Olson: Macht und Wohlstand. Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2002, 203 Seiten, 59 Euro.
Immerhin zwei Jahre hat es gedauert, bis ein deutscher Verlag das letzte Werk Mancur Olsons (1932 bis 1998) in übersetzter Fassung herausgebracht hat. Noch länger liegt es zurück, daß ein Journalist durch einen Anruf den amerikanischen Ökonomen zu jener Untersuchung angeregt hat, die in seinem Buch "Power and Prosperity" zusammengefaßt ist. Es war am 19. August 1991, am ersten Tag des Putsches gegen Michail Gorbatschow, daß sich Olson mit der in vielen Köpfen herumspukenden Frage konfrontiert sah, ob die einzige Hoffnung für die festgefahrene Sowjetwirtschaft nicht vielleicht in einer aufgeklärten Diktatur läge, die dem Land eine Marktwirtschaft aufzwingen würde. War nicht Chile unter der marktwirtschaftlich orientierten Diktatur Augusto Pinochets, Singapur unter Lee Kuan Yew und China unter Deng Xiaoping auf die Beine gekommen? Muß also eine totalitäre Macht die Menschen zu ihrem wirtschaftlichen Glück und Wohlstand zwingen? Da Marktwirtschaft und Demokratie zumeist als ergänzende Teile einer freiheitlichen Ordnung begriffen werden, hängt viel von der Antwort auf diese pragmatisch gemeinte, unvermindert aktuelle Frage ab.
Olson mußte zunächst dem Journalisten gestehen: "Das Problem war, daß ich keine Antworten wußte." Jahrelange Forschung am "Center on Institutional Reform and the Informal Sector" der University of Maryland jedoch vermittelte ihm schließlich die empirisch untermauerten Erkenntnisse, die für Antworten notwendig waren. In seinem Buch an der Schwelle von Ökonomie und Politik, dem er - kaum merklich - nicht mehr den letzten Schliff geben konnte, erklärt Olson zunächst, wie es kommt, daß manche Diktatoren tatsächlich Interesse haben, ihrem Land eine gedeihliche Wirtschaftsordnung zu geben, auch wenn sie keine altruistischen Motive verfolgen.
Er skizziert die Rolle eines Diktators in Analogie zum plastischen Bild des "stationären Banditen" und bedient sich der Unterscheidung zwischen "engen" und "umfassenden Interessen", die er schon in seinem berühmten Werk "Aufstieg und Niedergang von Nationen" (1982) entwickelt hat: "Der einzelne Räuber erhält nur einen kleinen Anteil an jedem Verlust oder Vorteil für die Gesellschaft, so daß er den Schaden ignoriert, den sein Diebstahl der Gesellschaft zufügt. Im Gegensatz dazu hat die Mafiafamilie, die das Verbrechen in einem Gemeinwesen monopolisiert, ein mäßig umfassendes Interesse oder einen mäßigen Anteil am Einkommen dieses Gemeinwesens." Der am Ort verweilende Bandit oder Diktator hat nicht nur ein eigenes Interesse daran, sein Gemeinwesen nicht grenzenlos auszunehmen, er hat auch einen Anreiz, öffentliche Güter bereitzustellen, um die Quellen seiner Macht und seines Einkommens zu erhalten. Allgemein gilt: "Je umfassender ein Interesse ist, desto geringer sind die sozialen Verluste aus einer Umverteilung durch das herrschende Interesse an sich selbst." Diese Regel gilt noch stärker, wenn sich der Planungshorizont des Regenten dadurch verlängert, daß er eine dynastische Erbfolge einführt.
Wie kann es nun dazu kommen, daß sich eine autokratische Diktatur in eine Demokratie wandelt? Häufig stehe purer Druck von außen dahinter, schreibt Olson; viele demokratische Ordnungen - wie in Deutschland - seien nach militärischen Niederlagen durch die Siegermächte eingerichtet worden. Es gebe aber auch historische Zufälle, die "ein Machtgleichgewicht zwischen einer kleinen Zahl von Führern, Gruppen oder Familien" bewirkten, die es für jeden einzelnen unklug erscheinen lasse, die anderen zu überwältigen. Dann sei Kooperation und Streitvermeidung die einzig sinnvolle Strategie, und somit könne die Logik der "Machtteilung" und "Machtbegrenzung" einer repräsentativen Demokratie greifen. Auf dieser Grundlage erweise sich dann rasch, daß Rechtsregeln für die Definition und den Schutz von Eigentumsrechten, für die Durchsetzung von Verträgen und für die Lösung von Streitfällen durch ein willkürfreies Rechtswesen im gemeinsamen Interesse liegen - und das sei die wesentliche Voraussetzung einer Marktwirtschaft. Auch wenn der Planungshorizont eines demokratischen Amtsträgers kürzer sei als die eines typischen Autokraten, betont Olson, stehe das Recht in einer Demokratie auf festerem Boden: dank der Unabhängigkeit der Gerichte. Mit dieser Feststellung führt der Autor zurück zu seiner Ausgangsfrage, ob Diktaturen nicht vielleicht sogar sinnvoll und damit besonders in Übergangsphasen hilfreich sind - und kann sie getrost verneinen.
Warum nun sind die Volkswirtschaften des ehemaligen Ostblocks so festgefahren? Wieso folgte auf den Zusammenbruch des Sozialismus kein Wirtschaftswunder wie nach dem Ende des Faschismus? Warum hat sich in Rußland so rasch eine erdrückende Mafia herausgebildet? Liegt es an der Verdrehung der Mentalitäten durch ein System, das zu lange jegliches wirtschaftliche Handeln pervertiert und in den Untergrund verschoben hat? Zur Beantwortung greift Olson auf die Argumentation aus seinem bahnbrechenden Buch "Die Logik des kollektiven Handelns" (1965) zurück, in dem er unter anderem gezeigt hat, daß sich kleine Gruppen mit "engen" Interessen leichter organisieren können als große und daß sie gerade deshalb der wirtschaftlichen Effizienz und Dynamik ihres Landes schaden. Generell sei zu erwarten, "daß Gesellschaften mit einer guten rechtlichen Ordnung nach einer Katastrophe, welche die Organisationen für kollektives Handeln zerstört haben, für eine gewisse Zeit außergewöhnlich schnell wachsen werden". Doch genau diese Zerstörung habe in Rußland nicht stattgefunden; die alten Seilschaften seien nicht verschwunden, sondern sie hätten sich schlicht neue Inhalte gesucht.
Deren Werden und Wirken beschreibt Olson im Detail. Wer eine aufgeklärte Analyse des sowjetischen Wirtschaftssystems sucht, stößt hier auf eine Goldgrube. Von der Steigerung der Sparquote und der Investitionen durch Konfiskation, der Ankurbelung der Arbeitsmotivation durch progressive Stücklöhne und leistungsabhängige Steuerdiskriminierung bis hin zur Einrichtung eines Systems gegenseitiger Kontrolle der Untergebenen - Olson verdeutlicht die ganze wohlüberlegte "brutale und listige Innovation" stalinistischer Wirtschaftspolitik, in der die sozialistische Ideologie nichts weiter war als eine "Nebelwand" vor dem Streben nach Erhaltung und Ausweitung der Macht. Dabei trage das System der gegenseitigen Überwachung den Keim von Korruption und Verbrechen in sich, so daß es zum "Bewegungsgesetz von Gesellschaften sowjetischen Typs" gehöre, "daß es im Laufe der Zeit bergab geht".
Jede der konspirativen Cliquen, Lobbys und Verbände habe einen so geringen Anteil am Gesamtoutput der Gesellschaft, daß sie wenig oder keinen Anreiz verspürten, die Produktivität der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. "Im Laufe seiner Entwicklung mußte der Kommunismus zusammenbrechen." Und an seinem Erbe, dem "Konflikt zwischen parasitären und produktiven Sektoren" der Wirtschaft, trügen die Gesellschaften noch heute schwer: "Der sklerotische Niedergang des von Stalin errichteten Systems des Auspressens" habe "den früheren kommunistischen Ländern große Unternehmen" hinterlassen, "welche die Tätigkeit der Insiderlobby weit besser beherrschten als die der Produktion".
Im Gegensatz zu dieser schlüssigen Erklärung der Schwierigkeiten im Transformationsprozeß fällt Olsons theoretische Auseinandersetzung mit dem konsequent freiheitlichen, "libertären" Ansatz aus. Von diesem moralisch begründeten Standpunkt aus ist das einzige, was zählt, die Handlungsfreiheit der Individuen. Ihnen wird zugetraut, ihre Interessen nach einem Wunsch zu regeln, selbst die notwendigen Institutionen zu schaffen und auch Rechte durchzusetzen. Olson sitzt einem Mißverständnis auf, wenn er davon ausgeht, daß dies mit einer anarchischen Utopie gleichzusetzen sei, nach dem Motto: "Solange Menschen frei sind zu wählen, befinden wir uns automatisch in der effizientesten aller möglichen Welten." Nur die wenigsten Libertären würden das behaupten. Vielmehr verweisen sie auf die Schwierigkeit, überhaupt einen Effizienzbegriff sinnvoll zu fassen. Zudem sind sie in ihrer Freiheitsliebe so standfest, einen möglichen, wie auch immer definierten Effizienzverlust in Kauf zu nehmen. Olsons Vorwurf, dieser Ansatz sei weder in der Lage, schlechte soziale Ergebnisse zu erklären (zum Beispiel warum manche Länder ärmer sind, als ihre Ressourcenausstattung erwarten lasse), noch warum Verträge einer autoritativen Durchsetzung bedürften, geht nicht nur am Kern des libertären Standpunkts vorbei, sondern ist schlicht nicht korrekt.
KAREN HORN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main