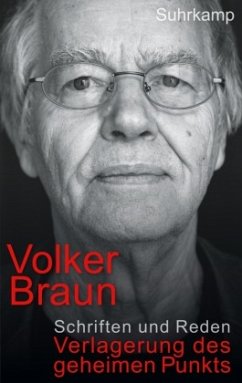Machwerk oder Das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
19,80 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In einer Gegend, die es "hinter sich hat", ist Meister Flick unter die Arbeitslosen geraten. War er einst bei Havarien im Tagebau der Niederlausitz gefragt, wird er jetzt, mit 60, auf dem Amt vorstellig. Bereitwillig übernimmt er jeden Auftrag: Abfallbeseitigung in den Gruben, Museumswärter und sonstige 1-Euro-Jobs. Wird er nicht vermittelt, beschäftigt er sich selbst und nimmt einem Bautrupp die Schaufeln ab, setzt bestreikte Werkhallen in Gang oder hilft einer Frau beim Sterben. Wurde Flick früher zu Unfällen gerufen, führt er selbst jetzt die Katastrophen herbei. Trotz bester Absicht ...
In einer Gegend, die es "hinter sich hat", ist Meister Flick unter die Arbeitslosen geraten. War er einst bei Havarien im Tagebau der Niederlausitz gefragt, wird er jetzt, mit 60, auf dem Amt vorstellig. Bereitwillig übernimmt er jeden Auftrag: Abfallbeseitigung in den Gruben, Museumswärter und sonstige 1-Euro-Jobs. Wird er nicht vermittelt, beschäftigt er sich selbst und nimmt einem Bautrupp die Schaufeln ab, setzt bestreikte Werkhallen in Gang oder hilft einer Frau beim Sterben. Wurde Flick früher zu Unfällen gerufen, führt er selbst jetzt die Katastrophen herbei. Trotz bester Absicht füllt sich sein Schichtbuch mit seltsamen Einsätzen: Die Arbeitswelt, in der er seinen Platz sucht, gibt es nicht mehr. Begleitet wird er von Luten, seinem Enkel und Gegenpart, der die Arbeit nicht gerade erfunden hat.Flick von Lauchhammer rennt in 48 Schwänken gegen die globalen Windräder an: ein komisch-philosophisches Schelmenstück in der Welt der "Arbeit nach der Arbeit", eine moderne Donquichotterie und große und heiter glänzende Literatur.