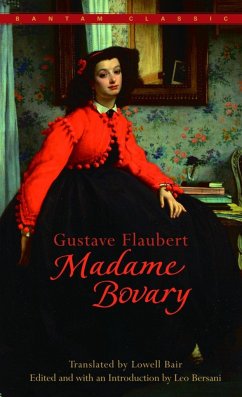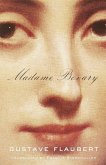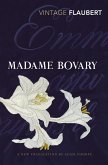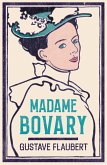This exquisite novel tells the story of one of the most compelling heroines in modern literature--Emma Bovary. "Madame Bovary has a perfection that not only stamps it, but that makes it stand almost alone; it holds itself with such a supreme unapproachable assurance as both excites and defies judgement." - Henry James Unhappily married to a devoted, clumsy provincial doctor, Emma revolts against the ordinariness of her life by pursuing voluptuous dreams of ecstasy and love. But her sensuous and sentimental desires lead her only to suffering corruption and downfall. A brilliant psychological portrait, Madame Bovary searingly depicts the human mind in search of transcendence. Who is Madame Bovary? Flaubert's answer to this question was superb: "Madame Bovary, c'est moi." Acclaimed as a masterpiece upon its publication in 1857, the work catapulted Flaubert to the ranks of the world's greatest novelists. This volume, with its fine translation by Lowell Bair, a perceptive introduction by Leo Bersani, and a complete supplement of essays and critical comments, is the indispensable Madame Bovary.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Dieser Roman war genau die Zumutung, für die der Staatsanwalt ihn hielt - zur Neuausgabe von Gustave Flauberts "Madame Bovary" /
Von Georg M. Oswald
Es muss eine Zumutung ganz besonderer Art gewesen sein, als Gustave Flaubert 1849 seine Freunde Louis Bouilhet und Maxime Du Camp einlud, um ihnen die erste Fassung seines Romans "Die Versuchung des heiligen Antonius" vorzulesen. In voller Länge, versteht sich. Und es ist ein schönes Beispiel dafür, dass Freunde einander die Wahrheit sagen sollten, denn nach stunden- und tagelangem Zuhören wollten sie sich mit ihrer Meinung nicht länger zurückhalten. Sie hatten sich derart gelangweilt, dass sie Flaubert rieten, vom heiligen Antonius abzulassen und sich stattdessen ein "sujet terre à terre" zu suchen, etwas Bodenständiges, etwas von dieser Welt. Die Einwände seiner Freunde müssen so vehement wie überzeugend gewesen sein, denn Flaubert folgte ihnen aufs Wort und wandte sich einem Stoff zu, der heute zu den bekanntesten der Weltliteratur zählt. Es handelte sich um eine Zeitungsgeschichte, die in diesen Jahren von sich reden machte: Der Fall der Delphine Delamare, die in dem normannischen Dorf Ry bei Rouen mit einem unbedeutenden Landarzt verheiratet war, aus Langeweile die Ehe brach, Schulden machte und sich 1848 im Alter von 26 Jahren vergiftete.
Fast fünf Jahre lang arbeitet Flaubert Tag für Tag mit unendlicher Mühe und Geduld an der Formung des, wie es in vielen Darstellungen heißt, "banalen" Stoffes. Ein verräterisches Adjektiv. Banal kann diesen Stoff nur finden, wer glaubt, die Kunst, die Literatur müsse, wo nicht Erhabenes, zumindest Erhebendes zum besten geben. Dieser Gemeinplatz ist der geistige Nährboden für den Skandal, den das Buch bei seinem Erscheinen verursachte, und die Anklage, die es verbieten wollte.
Fünf Jahre arbeitet Flaubert mit größter Hartnäckigkeit tagtäglich an diesem Roman, der darüber hinaus auch die Erfindung eines neuen literarischen Programms ist: ein aus der Abkehr von der Romantik entstandener Realismus, der auf eine schonungslose Entlarvung der Gegenwart zielt. Beinahe täglich gibt Flaubert in unzähligen Briefen über diese Arbeit Auskunft. Er schreibt, er korrigiert, korrigiert wieder, er liest laut, er brüllt, was er geschrieben hat, aus dem Fenster und korrigiert noch einmal. Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort, Satz für Satz, Szene für Szene. Noch in der letzten Fassung vor Drucklegung des Buches, nach Hunderten von Korrekturgängen, nimmt er hie und da letzte, winzige Veränderungen vor.
Die Briefe seien jedem zur Lektüre empfohlen, der glaubt, Literatur sei in erster Linie eine Frage der Inspiration. Die meisten von ihnen sind an Louise Colet adressiert, eine Lyrikerin und seine engste literarische Vertraute in diesen Tagen. Seine Figuren seien ihm zuwider, teilt er ihr mit. Man könnte fragen: Warum schreibt er dann nicht über andere? Die Antwort lautet: Weil es ihm notwendig erscheint. Allen Figuren Flauberts in "Madame Bovary" ist mehr oder weniger zu eigen, was ihm als der Fluch seiner Epoche erscheint: die Floskelhaftigkeit des Denkens, die Vorhersehbarkeit der Gefühle, das Fehlen jeglicher Originalität, die Oberflächlichkeit und, am allerschlimmsten, das Fehlen jedes Bewusstseins davon, dass es so ist.
Dieses Verdikt trifft keineswegs nur den gehörnten Einfaltspinsel Charles. Es trifft genauso auf den notorischen Gewinner Homais zu, den Apotheker, der, wie der letzte Satz des Romans zu berichten weiß, schließlich das Kreuz der Ehrenlegion erhalten haben soll. Was für ein Hohn! Vor allem er ist so ein Meister des geborgten Denkens. Doch auch Emma Bovary opfert ihr Leben uneigentlichen Gefühlen, von denen sie glaubt, sie müsse sie empfinden, weil sie das bei den Romantikern gelesen hat. Ihre Sehnsucht nach Inbrunst lässt sie, auch vor sich selbst, verzweifelt vorgeben, Inbrunst zu empfinden. Aber es bleibt eine unwahre Pose. Flaubert hatte recht, es war dies der Fluch der Epoche. Und obwohl er sie zutiefst verachtete, ging er doch hinaus, um jedes noch so nichtig erscheinende Detail zu studieren und zu beschreiben.
Das Ergebnis, der Roman, lässt am Ende keinen Zweifel. Hier schreibt ein Feind der Gesellschaft. Doch Flaubert ist kein politischer Feind. Er hasst das Bürgertum nicht wie ein Umstürzler. Er hasst es vom Standpunkt eines verhinderten Romantikers aus, der sich der akribischsten realistischen Methode bedient, um sein Personal in jedem Sinne des Wortes vorzuführen, als handle es sich bei dem Roman um einen literarischen Racheakt. Die Verachtung des Bürgertums entsprach dabei durchaus einer Zeitströmung. In den Jahren nach 1848 war das Wort "Bourgeois" zum Schimpfwort geworden. Der Apotheker Homais ist mit seiner geschäftstüchtigen Gefühllosigkeit, der unerträglichen Prahlerei, mit seiner Halbbildung und seinem todesverachtenden Sinn für Profit ein besonders schlimmes Beispiel dafür, was aus den Ideen der Aufklärung hatte werden können.
Elisabeth Edl findet in ihrer Übersetzung einen Ton, der Flauberts beißende Ironie, die manchmal grob, dann wieder sehr versteckt sein kann, überzeugend trifft. Doch es ist nicht so, dass es einem der Autor leichtmachte. Die entscheidenden Schlussfolgerungen überlässt er dem Leser. Eben weil er auf die beschriebene fundamentale Verunsicherung traf, erregte er die Gemüter so sehr. Die bürgerliche Gesellschaft, die für die Definition und Einhaltung allgemeinverbindlicher Werte zuständig sein sollte, wurde allein von ihrer brüchigen Fassade zusammengehalten. Was sie wusste, wusste sie aus zweiter Hand, was sie glaubte, glaubte sie nicht wirklich. Und sie hatte keine Antwort auf die Frage parat, wie ein würdiges und erfülltes Leben zu führen sei.
Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, dass das Erscheinen des Romans sofort Skandal machte. Hier einige Eigenschaften, die dem Autor und seinem Werk von der Kritik bescheinigt wurden: Seelenlosigkeit, Kälte, holpriger Stil, Dürftigkeit der Sensibilität, entsetzliche Gefühllosigkeit, ohne jeden Zauber, mit einer steinernen Feder geschrieben, gleich dem Messer der Wilden. Hier, was der Kritik vom Autor bescheinigt wurde: "Die Kritik rangiert in der Literatur auf dem untersten Platz, beinahe immer als Form und unbestreitbar als moralischer Wert. Sie kommt noch nach dem Schüttelreim und dem Akrostichon, die immerhin irgendeine Erfindungstätigkeit erfordern." Oder: "Je besser ein Werk ist, desto eher weckt es Kritik. Das ist wie mit den Flöhen, die sich auf die weiße Wäsche stürzen." Nicht nur Kritiker, auch den Staatsanwalt ruft "Madame Bovary" auf den Plan, der Anklage gegen Flaubert erhebt wegen der "Vergehen des Verstoßes gegen die öffentliche und religiöse Moral sowie gegen die Sittlichkeit".
Es ist eine öffentliche, strafrechtliche Klage, die hier geführt wird. Schon allein aus dieser schlichten Tatsache lässt sich die Dimension ableiten, die der Affäre zugeschrieben wurde. Nicht die Rechte eines Einzelnen sollen hier verletzt worden sein, sondern die des Staates, der ganzen Gesellschaft. Auch wenn die Anklage für unsere Ohren reichlich vage, um nicht zu sagen geschmäcklerisch formuliert wirkt: Sie beruht auf der Anwendung der damals geltenden Gesetze auf den Fall. Die angeblich verletzten Vorschriften werden genau zitiert. Doch der Staatsanwalt tut sich mit der Begründung seiner Anklage schwer, denn er spürt zwar die Erschütterung, die der Roman auslöst, aber er kann sie nicht benennen. Seine Strategie läuft darauf hinaus, das Ungesagte des Romans auszusprechen. Für eine strafrechtliche Anklage eine denkbar schwache Position.
Der Verteidiger kann es sich demgegenüber leisten, siegesgewiss aufzutreten. Denn wenn es darum geht, Flaubert als einen hochgeachteten Bürger erscheinen zu lassen, fällt das nicht schwer. Sein Vater war Klinikdirektor in Rouen, sein Bruder ist es zur Zeit des Prozesses, die Familie ist angesehen und wohlhabend, Flaubert selbst wird als ernsthafter und von hochmoralischen Motiven geleiteter Privatgelehrter dargestellt.
Er selbst scheint sich über den Ausgang des Prozesses keineswegs sicher gewesen zu sein. In den Gerichtssaal hatte er einen Schreiber mitgenommen und ihn beauftragt, Wort für Wort die Plädoyers von Staatsanwalt und Verteidigung mitzuschreiben. Die Dummheiten, die man ihm entgegenhielt, sollten der Nachwelt in allen Details erhalten bleiben.
Diese Mitschriften sind in der Neuausgabe des Romans, die der Hanser-Verlag veranstaltet hat, zum ersten Mal vollständig auf Deutsch enthalten, ebenso wie das Urteil. Es ist ein Freispruch, doch er fällt nicht überzeugend aus. Warum sollte die hochmoralische Intention des Autors, die angeblich dem Text selbst gar nicht zu entnehmen ist, letztlich seine Unschuld begründen? Man lasse sich nicht täuschen. Madame Bovary ist genau die Zumutung, für die sie der Staatsanwalt gehalten hat.
Gustave Flaubert: "Madame Bovary". Roman. Herausgegeben und aus dem Französischen übersetzt von Elisabeth Edl. Hanser-Verlag, 760 Seiten, 34,90 Euro. Von Georg M. Oswald erschien zuletzt der Roman "Unter Feinden".
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main