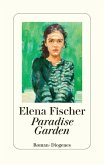Die Welt der russisch-jüdischen Familie aus Hamburg, um die es in Maxim Billers neuem Roman »Mama Odessa« geht, ist voller Geheimnisse, Verrat und Literatur. Wir lesen aber auch ein kluges, schönes und wahrhaftiges Buch über einen Sohn und eine Mutter, beide Schriftsteller, die sich lieben, wegen des Schreibens immer wieder verraten - und einander trotzdem nie verlieren.
Mit beeindruckender Leichtigkeit spannt Maxim Biller einen Bogen vom Odessa des Zweiten Weltkriegs über die spätstalinistische Zeit bis in die Gegenwart. Alles hängt bei der Familie Grinbaum miteinander zusammen: das Nazi-Massaker an den Juden von Odessa 1941, dem der Großvater wie durch ein Wunder entkommt, ein KGB-Giftanschlag, der dem Vater des Erzählers gilt und die Ehefrau trifft, die zionistischen Träumereien des Vaters, der am Ende mit seiner Familie im Hamburger Grindelviertel strandet, wo nichts mehr an die jüdische Vergangenheit des Stadtteils erinnert - und wo er aufhört seine Frau zu lieben, um sie wegen einer Deutschen zu verlassen. Dennoch scheint ständig ein schönes, helles Licht durch die Zeilen dieses oft tieftraurigen, außergewöhnlichen Buchs.
»Mama Odessa« ist ein literarisches Meisterstück von größter Präzision und poetischer Kraft, wie es auf Deutsch nur selten gelingt.
Mit beeindruckender Leichtigkeit spannt Maxim Biller einen Bogen vom Odessa des Zweiten Weltkriegs über die spätstalinistische Zeit bis in die Gegenwart. Alles hängt bei der Familie Grinbaum miteinander zusammen: das Nazi-Massaker an den Juden von Odessa 1941, dem der Großvater wie durch ein Wunder entkommt, ein KGB-Giftanschlag, der dem Vater des Erzählers gilt und die Ehefrau trifft, die zionistischen Träumereien des Vaters, der am Ende mit seiner Familie im Hamburger Grindelviertel strandet, wo nichts mehr an die jüdische Vergangenheit des Stadtteils erinnert - und wo er aufhört seine Frau zu lieben, um sie wegen einer Deutschen zu verlassen. Dennoch scheint ständig ein schönes, helles Licht durch die Zeilen dieses oft tieftraurigen, außergewöhnlichen Buchs.
»Mama Odessa« ist ein literarisches Meisterstück von größter Präzision und poetischer Kraft, wie es auf Deutsch nur selten gelingt.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Äußerst angetan ist Rezensent Volker Weidermann von Maxim Billers Roman. Leicht verfremdet erzählt dieser die Lebensgeschichte von Rada Biller, der Mutter des Autors. Die war, lernen wir, selbst Schriftstellerin, hatte jedoch lange nicht die Möglichkeit, ihre Texte zu veröffentlichen. Weidermann nennt das Buch eine Liebesgeschichte, in der es auch darum gehe, wie der Sohn sich gegen eine feindliche Umwelt schützt, indem er seinen Hass kultiviert. Die Mutter im Buch freut sich laut Kritiker, dass der Sohn an ihrer statt zum Schriftsteller wird, findet aber auch, dass er ihr gelegentlich die Themen stiehlt, etwa wenn es um seinen Vater geht. Vielschichtig und ehrlich ist dieses Buch, lobt der Rezensent, im Blick auf die Mutter, die oft allein und einsam bleibe, und auf den Sohn, der lerne, seiner Umwelt gegenüber hart zu werden. Es ist dieses Wechselspiel von mütterlicher Prosa und Fortschreibungen des Sohnes im Leben, das Weidermann besonders für das Buch einnimmt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»... ein leichtes, schweres Meisterwerk - und das gegenwärtig beste erste Kapitel der deutschen Literatur« Marlene Knobloch Süddeutsche Zeitung 20230816

Diesmal hatte ich mir sogar noch weniger
ausgedacht als davor: Maxim Billers "Mama Odessa" ist die Reflexion eines traurigen
Emigrantenromans.
Ein rotes Sofa, auf dem erst Mutter und Vater sitzen, dann Mutter und Sohn und schließlich der Sohn allein: Dieses vergleichsweise simple, aber wirkungsvolle Motiv von Familienzusammengehörigkeit wie auch deren Auseinandergehen bringt das Thema von Maxim Billers neuem Roman Mama Odessa bereits auf den Punkt. Noch dazu handelt es sich um eine motivische Übernahme, denn das Sofa tauchte bereits im vorherigen Familienroman des Schriftstellers auf: In "Sechs Koffer" (2018) ruht sich der Vater des Erzählers nach der Arbeit auf dem Sofa im Arbeitszimmer aus, er liebt das Sofa. Die Mutter hingegen hat es von Anfang an gehasst, das gilt in "Sechs Koffer" genauso wie nun in "Mama Odessa".
Trotz dieser Analogie liegen auch einige Unterschiede zwischen den beiden Romanen. Während in "Sechs Koffer" die Fluchtgeschichte nach Prag und Hamburg als unmittelbar zurückliegende Erinnerung erzählt wird, liegt sie in "Mama Odessa" ferner, erklingt in den Figuren nur noch als Echo. In gewisser Weise wird der Herkunftsort Odessa für den Erzähler Mischa, seine Mutter und seinen Vater zum Sehnsuchtsort, unerreichbar, aber nach wie vor mit allem Gegenwärtigen verwoben. "Warum war keiner von uns Dreien jemals wieder nach Odessa gefahren, wenn es uns in Deutschland so wenig gefiel?": Darauf sucht Mischa im Erzählen eine Antwort. Neben der Herkunft handelt der Roman somit von einem weiteren Biller-Evergreen, dem - in den Worten des Literaturwissenschaftlers Kai Sina - "meist verkrampften, oft auch verlogenen, in jedem Fall aber komplizierten Zusammenleben von Juden und Nichtjuden in Deutschland".
Der Titel "Mama Odessa" spielt auf beide der zentralen Themen an: Zum einen ist das die bereits geschilderte Beziehung zur Herkunft aus Odessa, in der sich für den Erzähler eine Art Mutter aller Geschichten verbirgt, da sein Schreiben über die Familiengeschichte besonders um diesen Ort kreist. Und zum anderen geht es um die Beziehung Mischas zur eigenen Mutter Aljona Grinbaum, die seit ihrer Kindheit davon träumt, Schriftstellerin zu werden und schließlich im Alter von 68 Jahren ihren ersten Band mit Erzählungen veröffentlicht. Dabei hatte ihr Sohn ihre Erzählungen eher als Notlösung - aufgrund von "immer länger werdenden Telefongesprächen" - an seine Lektorin geschickt, um seiner Mutter über die Scheidung und die Einsamkeit im Alter hinwegzuhelfen: "Statt aber für ein paar Tage zu ihr zu fahren, sie ein bisschen zu trösten und ihre Hand zu streicheln, hatte ich bald eine bessere Idee, wie ich ihr helfen könnte, ohne für eine solche sinnlose Reise Zeit und Konzentration zu opfern."
Nun ist Aljona verstorben, und als Mischa in ihre Wohnung in der Bieberstraße in Hamburg einzieht, findet er in ihrem Arbeitszimmer unveröffentlichte Geschichten und an ihn adressierte Briefe, die seine Mutter nie abgeschickt hat. Mit dem Lesen dieser Dokumente erwachen im Erzähler alte Erinnerungen an die Mutter, den Vater, aber auch die kurze Kindheit in Odessa: den Hof in der Gogolskaja, in dem alle Erwachsenen der jüdischen Nachbarschaft zusammensaßen und redeten, aber auch die Verhöre, zu denen sein Vater teilweise tagelang festgehalten wurde. Dabei ist diese Retrospektive, egal ob die eigene oder die der Mutter, für Mischa mit Schmerz verbunden: "Würden noch mehr von diesen Erinnerungen zu mir zurückkommen, wenn ich über das lange Sterben meiner Mutter weiterschreiben würde? Ja, das glaube ich. Aber will ich das?"
Wie gewohnt erzählt Biller dabei eng an seiner eigenen Lebensrealität entlang, ein Verfahren, zu dem er sich unter anderem in seinen Essays stark selbst bekennt, und das seit dem inzwischen verbotenen Roman "Esra" nicht mehr nur literaturwissenschaftlich, sondern auch vor Gericht diskutiert wurde. Und auch im aktuellen Roman wird thematisiert, wie das Umfeld des Erzählers wütend darauf reagiert, selbst zu Literatur verarbeitet zu werden: "Diesmal hatte ich mir sogar noch weniger ausgedacht als davor, und dafür mochten mich die Leute noch lieber - aber mein Vater redete deswegen kaum noch ein Wort mit mir." Das Schreiben über die eigene Familie und das eigene Leben belastet dabei auch das Verhältnis zwischen Mischa und seiner Mutter; besonders da nun ausgehandelt werden muss, wer von beiden über welche Ereignisse der Familiengeschichte schreiben darf. Als der Erzähler eine Erinnerung der Mutter zum Thema einer seiner Geschichten macht, wirft sie ihm vor: "Das war mein Stoff, verstehst du? Du hast ihn mir geklaut. Du warst doch damals gar nicht dabei und du weißt auch nicht, wie es ist, so krank zu sein."
Dadurch liest sich "Mama Odessa" wie ein klassischer Biller - oder, in den Worten Mischas, wie ein weiterer "trauriger Emigrantenroman", in dessen rührender und zugleich bissiger Sprache die Verletztheit des Erzählers durchschimmert. Auch sein Gespür für das kurzweilige Erzählen stellt Biller abermals unter Beweis, denn jeder der insgesamt 34 Abschnitte ist in sich geschlossen, steht für sich allein. Meist durch einen alten Brief der Mutter oder ein anderes Relikt eingeleitet, taucht Mischa in die Vergangenheit ein und schließt mit einem Fazit oder einem Kommentar dazu. Erinnerung nach Erinnerung wird in dieser Weise ausgeführt; jede einzelne sticht wie eine feine Nadel. Von dem selbst zugefügten Schmerz verspricht sich der Erzähler vielleicht aber doch eine therapeutische Wirkung. EMILIA KRÖGER
Maxim Biller: "Mama Odessa". Roman.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. 240 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Rezensentin Emilia Kröger entdeckt nichts Neues in Maxim Billers neuem Roman. Das Thema der Emigration und des Leidens an der ungeliebten neuen Heimat Deutschland, dazu ein rühriger wie bissiger, mit allerhand autobiografischen Details gespickter Blick auf die jüdische Familie, der Verletztheit signalisiert - alles wie gehabt, meint sie. Doch auch nicht so schlecht, scheint sie zu denken. Dieser "Biller-Evergreen" in Episoden ist kurzweilig und unterhaltsam, so Kröger.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH