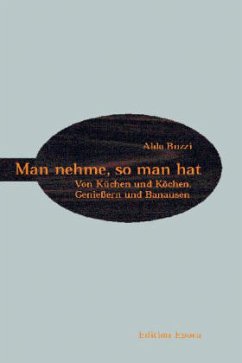Produktdetails
- Verlag: Edition Epoca
- Originaltitel: L' uova alla Kok
- 2. Aufl.
- Seitenzahl: 159
- Erscheinungstermin: Mai 2006
- Deutsch
- Abmessung: 210mm
- Gewicht: 272g
- ISBN-13: 9783905513356
- ISBN-10: 3905513358
- Artikelnr.: 12909180
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

In der Küche der Wahrheit: Der Schriftsteller Aldo Buzzi genießt
Trotz des kulinarischen Titels "Man nehme, so man hat. Von Küchen und Köchen, Genießern und Banausen" findet man am Ende dieses Buches keine Liste der erwähnten Realien oder nach Gruppen geordnete Rezepte. Man findet ein Personenverzeichnis, in dem kulinarisch wirklich relevante Namen - milde ausgedrückt - eher in der Minderzahl sind. Haben wir es also wieder einmal mit einem der vielen, wenig ersprießlichen Werke zu tun, in denen sich peripheres Interesse am Kulinarischen doch noch zu einem Bändchen von verkäuflichem Umfang kondensiert? Wohlgepolstert mit dem Fett kulturgesättigter Namen von Aristophanes bis Zola, aber mager in dem, was es mitzuteilen gäbe?
Dem 1910 geborenen italienischen Architekten, Schriftsteller und Übersetzer Aldo Buzzi - er übersetzte unter anderem Thomas Mann, Walter Benjamin und James Joyce, wurde aber auch durch die Veröffentlichung eines langjährigen Briefwechsels mit Saul Steinberg bekannt - scheint dieses Problem nur indirekt bekannt zu sein. "Der Schriftsteller", heißt es da, "der nie vom Essen, vom Appetit, vom Hunger, von Speisen, von Köchen, von Mahlzeiten spricht, macht mich mißtrauisch, ganz so, als fehle ihm etwas Wesentliches."
Im Prinzip hat er recht, der bisweilen ziemlich weise Herr Buzzi, den man sich trotz seines hohen Alters durch die Gassen italienischer Städte streifend vorstellt, da, wo es konkret wird, wo man auf Melonenstückchen ausrutschen kann, im Gewirr aus lauter Lieblingstrattorien und den malerisch hängenden Schinken und Würsten. Er scheint jedenfalls besser genährt als andere Peripheriker, denen partout nicht auffallen will, daß die kulinarischen Objekte ihnen nur deshalb so oberflächlich erscheinen, weil ihnen selbst die Skizze eines Schlüssels zu ihrer Erklärung fehlt. Wie kann man auch einen Menschen nicht ernst nehmen, der sich erstaunlich differenziert über die Gartechnik von Huhn an offenem Feuer äußert und dann vorschlägt: "(Man halte) ein Bündel wilden Fenchel oder einen Zweig Lorbeer (bereit), die man ganz zum Schluß auf der Kohle entzündet, um das Hähnchen kurz darüber zu schwenken".
Nachdem also der Legitimation des Herrn Buzzi Genüge getan ist, entfaltet sich vor dem Leser ein kurzweiliges Panorama um Essen und Eßkultur, das dank seiner regelmäßigen Rückkehr zu gelebtem Essen ohne weiteres auch einige Zitate verträgt. Wie jenes von Alexandre Dumas, der den bekanntesten Gastrosophen aller Zeiten, Brillat-Savarin, noch aus eigener Erfahrung als jemanden beschreibt, der nicht gewußt habe, wie man ißt, eher ein Vielfraß war, dafür aber "schreiben konnte". Mit Paul Bocuse teilt Buzzi die Vorliebe für gekühlten Rotwein und das volle Verständnis für die tagesfrische "Cuisine du marché", allerdings auch die Begrenztheit des Horizonts jenseits der klassischen Trampelpfade: "(Bocuse) rät davon ab, die Frühsorten (von Gemüse) zu kaufen. Hier muß man ihm unbedingt recht geben." Da interessiert ihn, warum die Bauern außerhalb von Neapel Bohnen mit Fäden züchten, während sie doch in Neapel "ohne die Spur eines Fadens sind", oder daß die Pasta nur soviel an Tomatensauce bekommen dürfen, daß sie rosa, aber nicht rot gefärbt sind.
Mit guter Übersicht nennt er den französischen Spitzenkoch Michel Guérard (etwa "La cuisine minceur", Paris 1976) den Koch, "der mehr als irgendein anderer die neuen Tendenzen der französischen Küche verkörpert", und schließt sich - mit erstaunlich wenig Übersicht - der Meinung Alberto Savinios an (Schriftsteller und Bruder von Giorgio De Chirico), der als einer der Urheber italienischen Küchenhochmuts gelten kann: "Die italienische Küche ist eine Küche der Wahrheit. Sie ist die Küche, zu der wir alle früher oder später unweigerlich zurückkehren werden, nach jedem unbesonnenen und glücklosen Abstecher, sei es zu den Vertilgern von Heuschrecken oder Verkostern von Quintessenzen."
Insgesamt wirkt Aldo Buzzi aber keineswegs nationalistisch und meidet - für die kulinarischen Ansichten seiner Generation eher selten - weitgehend den Schulterschluß mit dem gesunden Menschenverstand, dessen massenhafte Verbreitung ihn ja letztlich immer sehr ungesund werden läßt. Überraschend scharf fällt seine Zivilisationskritik aus, in der er den "Geschmacksverlust" als kulturelles Gesamtphänomen sieht und ihn unter anderem auch dort findet, wo man "Radios und Fernseher mit voller Lautstärke laufen läßt", wo man sich schämt, "wenn der Großvater sich die Serviette um den Hals bindet", wo Leute sich nicht in eine Schlange stellen können oder Vanillepulver statt echter Vanilleschoten verwenden.
In einer bunten Mischung von Fiktion und Nichtfiktion geht es vom Hölzchen aufs Stöckchen, und dennoch gewinnt man den Autor immer lieber, je mehr man ihn liest. "Die Welt gehört leider jenen, die im Unrecht sind", geht es also weiter, und zwischendurch folgt der Hinweis, daß die Hühnerbrühe in armen Ländern exzellent ist (weil man dort tatsächlich noch Hühner verarbeitet . . .), mit dem Einzug des Wohlstandes das Huhn aber zum Würfel wird. Altersunweisheiten, wie die pauschale Verwendung des Satzes "in Zeiten der Dekadenz wird der Küchenkult exzessiv", kann man Buzzi glatt verzeihen, weil er auch so wunderbare Dinge beschreibt wie den situativen Kontext des Genießens von "besonderen Speisen, wie die Schwarzwurzeln in Butter". Das "Man nehme" des Buchtitels wird um einen warmen Holzfußboden und eine "blütenweiße Decke" oder "Stühle mit gepolsterter Armlehne" erweitert und wirkt einmal gar nicht so wie die sterilen Handreichungen zu kultiviertem Leben.
Man kann also von einem interessanten, gebildet geschriebenen kleinen Büchlein berichten, das in vielen Facetten ungewohnte kulinarische Substanz erreicht - wenn auch nicht unbedingt in den eher klassisch angelegten Rezepten im Text. Es entsteht der Wunsch, daß es einmal gelingen möge, die Qualitäten eines guten Schriftstellers mit einer makellosen kulinarischen Substanz zu verbinden und mit diesem Wunsch sogleich die Hoffnung, daß daraus Neues entstehen könnte. Noch ist man - meist als Folge geradezu klassischer Selbstblockaden - ein klein wenig hintendran. Aldo Buzzi jedenfalls ist da eine beachtliche Ausnahme.
JÜRGEN DOLLASE
Aldo Buzzi: "Man nehme, so man hat". Von Küchen und Köchen, Genießern und Banausen. Aus dem Italienischen übersetzt von Bettina Kienlechner. Edition Epoca, Zürich 2005. 159 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Ijoma Mangold ist sehr beeindruckt von den Schriften des Italieners Aldo Buzzi, die er als gastrosophisch bezeichnet - und die in seinen Augen eine echte Ausnahmeerscheinung des Genres sind. Das liegt nach Mangolds Meinung vor allem daran, dass "bei ihm das Hohe und das Niedrige, das Derbe und das Feine überraschende Verbindungen eingehen". Zum Beispiel haben Buzzis Anekdoten und Anmerkungen einen Subtext, der andeutet, dass er ein Phänomen wie der Völlerei nicht pikiert ablehnt, sondern durchaus einen interessante Dimension darin sieht: "Dass das Nahrungsbedürfnis den Menschen animalisiert, ist für ihn keineswegs verächtlich." Trotzdem kommt bei ihm auch die "rigorose Raffinesse" nicht zu kurz. Kurzum: nach Mangolds Meinung ist das ein Buch, in dem "das Essen auf unaufdringliche Weise zur Metapher des Lebens verabsolutiert wird".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH