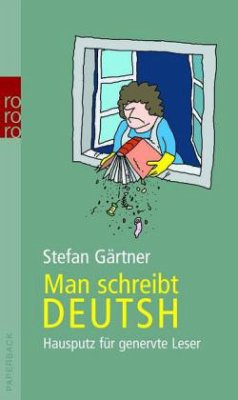Saubere Analyse des deutschen Fehl- und Falschgefasels.
Irgendwann kann man sich nicht mehr davor drücken: Es muß einmal aufgeräumt werden. Der Sprachunrat staubt in den Ecken, der Wort- und Satzmist aus Presse, Funk und Literatur stinkt zum Himmel, und die ganzen alten Metaphern gehören auch mal entsorgt. Bei diesem Dreck kann ja kein Mensch einen klaren Gedanken fassen! Dieses Büchlein kehrt mal richtig durch und sorgt für langanhaltende Frische.
Irgendwann kann man sich nicht mehr davor drücken: Es muß einmal aufgeräumt werden. Der Sprachunrat staubt in den Ecken, der Wort- und Satzmist aus Presse, Funk und Literatur stinkt zum Himmel, und die ganzen alten Metaphern gehören auch mal entsorgt. Bei diesem Dreck kann ja kein Mensch einen klaren Gedanken fassen! Dieses Büchlein kehrt mal richtig durch und sorgt für langanhaltende Frische.

Die Sprachkritik hat gut zu tun: Bücher von Zimmer und Gärtner
Nehmen wir das Wort "feige". Ist dies Adjektiv zulässig für die Selbstmordattentäter? Dieter E. Zimmer sagt nein: "Wären sie doch bloß etwas feiger!" meint er treffend und resümiert: "Der Selbstmordanschlag fordert Menschenleben und gibt bereitwillig das eigene dafür hin. Wenn das eines nicht ist, dann feige." Ein Sprachwissenschaftler würde so etwas nicht sagen. Zunächst interessiert ihn dies gar nicht. Er will den Leuten ja nicht sagen, wie sie reden sollen. Er flickt ihnen nicht am sprachlichen Zeug und will nur wissen, wie sie tatsächlich reden. Nur beschreiben will er und erklären. In diesem Fall würde er konstatieren - denn die Zusammenstellung "feiges Selbstmordattentat" ist in der Tat so häufig geworden, daß das Wort dabei ist, seine Bedeutung zu verändern. Richtiger: daß die Leute dabei sind, ihm eine andere Bedeutung zu geben; noch richtiger: ein anderes Wort aus ihm zu machen. Es meint nun etwas wie "moralisch tiefstehend" oder geradezu "hundsgemein".
Und der Linguist kann dies auch erklären. Die ritterliche Welt, in die das Wort hineingehörte, wird er argumentieren, ist verschwunden. Das Wort ist also - denn die alte Bedeutung ist nun nahezu unnötig - frei geworden, und das Element "gemein" war ja auch schon im alten "feige" enthalten. So baut die neue Bedeutung auf der gegebenen auf. Diese Auskunft ist nun wieder für den Sprachkritiker ganz unbefriedigend. Denn er weiß doch, was "feige" meint, was dieses Wort "eigentlich" - so sagt er dann - meint. Ihn stört diese Verwendung, weil sie mit der Bedeutung, die ihm zum festen Besitz wurde, ganz und gar nicht übereinstimmt. Für ihn ist es schlicht falsch, jemanden feige zu nennen, der dies nicht ist. "Manche Wörter bedeuten einfach nicht, was alle denken", sagt Zimmer und bezieht sich da auf den Gebrauch von "Flair": Die Leute sagen "Diese Stadt hat viel Flair" und meinen offenbar etwas wie "Atmosphäre", während das Wort eigentlich etwas anderes meint: "Spürsinn" oder, vom Hund her abgeleitet, "Witterung".
Ähnlich ging es dem Wort "Kontrahent": Es meinte eigentlich einen Vertragspartner und keineswegs wie jetzt meistens einen Gegner. Den Sprachkritiker stört dies, weil da eine "semantische Differenzierung" auf der Strecke bleibt. Immer sei dies ein "Verlust an Ausdruckskraft". Die Sprachwissenschaft hingegen ist hier hegelianisch: Alles, was (in der Sprache) ist, ist für sie vernünftig - sonst wäre es ja nicht. Daher ihr Desinteresse an Sprachkritik.
Sprachwissenschaft braucht Sprachkritik nicht. Wohl aber braucht Sprachkritik Sprachwissenschaft, denn diese ist nun einmal zuständig für das, was hier ist. Es ist irritierend, wer hier alles mitreden will - und wie dies dann mit dem für ihn selbst glückhaften Aplomb des Laien geschieht. Auch hier erkennt man diesen daran, daß er keine Fragen hat. Dies gilt nun gar nicht für Dieter E. Zimmer, denn er hat sich - und ist da eine schöne Ausnahme - ausgiebig linguistisch kundig gemacht. Besonders in seinem Buch "Sprache in Zeiten ihrer Unverbesserlichkeit" (2005) hat er dies bewiesen.
Mit dem neuen, ebenfalls vorzüglichen Buch "Die Wortlupe" kehrt er zur Sprachkritik zurück, hundertelf Sprachglossen in alphabetischer Folge von "Abbau" bis "Zumutung". Die Positiva des Buchs: Es ist gut orientiert, vernünftig, sensibel beobachtet (es bezieht sich auf die "aktuelle Mediensprache"), gut geschrieben, scharfzüngig, immer wieder auch witzig und, bei aller Entschiedenheit im Urteil, nicht schulmeisterlich. Der Rezensent hat da nur das ärgerliche Problem, nahezu durchweg einverstanden zu sein. Zimmer urteilt unter intellektuellen, auch unter ästhetisch-stilistischen Gesichtspunkten. Und natürlich geht es ihm immer auch um die Sache. Da berühren sich übrigens Sprachkritik und Sprachwissenschaft, denn auch diese kann die Sachen, die Welt, nicht draußen lassen. Aber Zimmers Kritik setzt doch immer beim Sprachlichen ein; sie ist - gute - Sprachkritik.
Anders Stefan Gärtner. Er ist entschieden jünger als Zimmer, aber doch auch schon deutlich in den Dreißigern. Sein Buch "Man schreibt Deutsh" geht von Sachen aus oder Personen. Ihn nervt zum Beispiel - da ist er wahrlich nicht allein - der "Stern"-Journalist Hans-Ulrich Jörges. Den kritisiert er ausgiebig, witzig und zu Recht: "Immer sind's die trägsten Köpfe und Redaktionssesselhocker, die sich dem Powerplay grenzenloser Dynamik verschrieben haben und nichts so hassen wie verkrustete Strukturen und Stillstand, dabei aber immer paßgenau dieselben Sätzchen aufsagen. So daß im Kopfbahnhof recht eigentlich - Stillstand herrscht."
Oder: "Wollen wir hoffen, daß es in Deutschland so überschaubar und klar zugeht wie in Jörgesschen Sätzen, die ihre gedankliche Deregulation schon hinter sich haben." Man sieht: Hier und weithin in dem Buch ist es so, daß das Sprachliche nur eben einbezogen wird in eine umfassendere und anderswoher motivierte Kritik. Den Autor stört jemand (Jörges) und dabei dann auch die dazugehörige Sprache. Weil also die Sprache hier nicht im Zentrum ist, ist dies Buch nicht Sprachkritik. Es ist nur einfach Kritik, die Sprachliches nicht ausläßt.
Gärtner nerven viele und vieles. Zum Beispiel "die Juli Zeh", die noch jünger ist als er und von der er schon ziemlich unmögliche Sätze zitiert, aber die brave Jenny Erpenbeck ("Bücher für Studienrätinnen") ist auch nicht sein Ding und Silke Scheuermanns "Schmuddelprosa" erst recht nicht (auch bei ihr reißt er Unsägliches aus dem Zusammenhang - aber so steht's da und dürfte so nicht dastehen). Übrigens ist er offensichtlich kein Feminist. Er mag aber auch "den Durs" (Grünbein) nicht und Michael Lentz, den "Dürener Doofkopp", noch viel weniger. Da kriegt denn auch, in diesem Zusammenhang, diese Zeitung was ab, auf die Gärtner sich überhaupt gern bezieht.
Kein Zweifel: Gärtner kann schreiben. Und dies in netter Form jugendlich frech und aggressiv (den Bundespräsidenten nennt er ungeniert "den Kapitaldackel"), und lustig ist er auch. Locker apart und gekonnt - genau! - seine Interjektionen! Also erfrischend insgesamt. Nicht immer jedoch sind seine Empörungen leicht nachzuvollziehen. Nicht immer scheint einem so unmöglich, was für ihn so ist. Und dann leiden Artikel, die einmal einzeln erschienen und ihren guten Sitz in einer Zeitschrift hatten (in der "Titanic"), durch ihre pure Zusammenstellung - auch wenn sie überarbeitet wurden.
HANS-MARTIN GAUGER
Dieter E. Zimmer: "Die Wortlupe". Beobachtungen am Deutsch der Gegenwart. Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2006. 223 S., geb., 14,95 [Euro].
Stefan Gärtner: "Man schreibt Deutsh". Hausputz für genervte Leser. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 2006. 188 S., br., 10,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Der Mann kann schreiben, konzediert Rezensent Hans-Martin Gauger. Mit großem Furor mache sich Stefan Gärtner unter Schriftstellern und Journalisten auf die Suche nach Zielen seiner Sprachkritik. Allerdings reiße der Autor die von ihm inkriminierten Sätze notorisch aus dem Zusammenhang, selbst wenn es ein literarischer ist. Anhand eines Gärtnerschen Lieblingsfeindes verdeutlicht der Rezensent, dass es dem Autor letztlich auch um das Denken hinter der Sprache gehe, er somit Sprachkritik als Mittel für eine allgemeinere Kritik und "Empörung" einsetze. Diese sei jedoch, moniert der Rezensent, nicht immer so richtig offensichtlich.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH