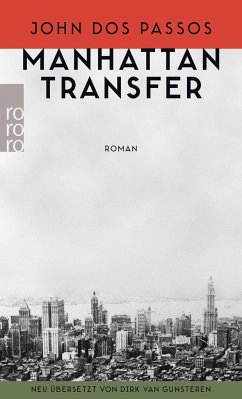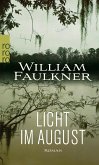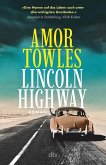Einer der einflussreichsten Romane des 20. Jahrhunderts in neuer Übersetzung - mit einem Nachwort von Clemens Meyer
Manhattan Transfer gehört zu den großen revolutionären Romanen des 20. Jahrhunderts. Durch eine Fülle von Schauplätzen und Charakteren lässt Dos Passos ein schillerndes Porträt des urbanen New Yorker Dschungels entstehen. Die Figuren des Romans - ein junger Einwanderer, ein Gewerkschaftsführer, ein Mörder, ein Karrierist, eine nach Selbstständigkeit strebende Frau, ein sensibler Alkoholiker und andere - scheinen aus der unbestimmbar großen Masse der Stadtbewohner herausgerissen, um irgendwann wieder in ihrem Gewühl unterzugehen. Der eigentliche Protagonist des Romans ist jedoch die Großstadt New York - eine immense, anarchische Macht, der alle ausgeliefert sind.
Manhattan Transfer gehört zu den großen revolutionären Romanen des 20. Jahrhunderts. Durch eine Fülle von Schauplätzen und Charakteren lässt Dos Passos ein schillerndes Porträt des urbanen New Yorker Dschungels entstehen. Die Figuren des Romans - ein junger Einwanderer, ein Gewerkschaftsführer, ein Mörder, ein Karrierist, eine nach Selbstständigkeit strebende Frau, ein sensibler Alkoholiker und andere - scheinen aus der unbestimmbar großen Masse der Stadtbewohner herausgerissen, um irgendwann wieder in ihrem Gewühl unterzugehen. Der eigentliche Protagonist des Romans ist jedoch die Großstadt New York - eine immense, anarchische Macht, der alle ausgeliefert sind.
Ein Urmeter der Moderne. Urknall des Großstadtromans. Die Welt
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Mit "Manhatten Transfer" hat John Dos Passos im Grunde das Genre des Großstadtromans begründet, erklärt Rezensent Alexander Cammann. Der amerikanische Autor hatte eine wilde Kollage aus kleinen Szenen, Sequenzen und Situationen zusammengestellt und mithilfe dieses vom Film inspirierten Kunstgriffs ein Panorama der Zeit zwischen 1896 und 1924 entworfen, fasst der Rezensent zusammen. Das ist lesens- und jetzt auch hörenswert, denn die hier vorgestellte Hörspiel-Fassung des Klassikers mit mehr als fünfzig Sprechern bietet eine kongeniale "akustische Soziologie der Moderne", lobt Cammann.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Das war überfällig: Dirk van Gunsteren hat John Dos Passos' berühmten Großstadtroman "Manhattan Transfer" neu übersetzt
"Manhattan Transfer", erschienen 1925, gilt als Meisterwerk des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Stichworte des modernen Großstadtromans verbinden sich mit dem Buch: die Metropole als Moloch, der zahllose Menschen ansaugt und ausspuckt, die dissonante Polyphonie der Schicksale, die Schrecken von Anonymität und Entfremdung, die krasse Konfrontation von Armut und Reichtum, Elend und Überfluss. Die New-York-Faszination ist bei Dos Passos durchsetzt mit Abscheu, dem Grauen vor dem wimmelnden Getriebe der Riesenstadt, Moderne als Projekt der Enthumanisierung. Siegfried Lenz, der 1980 einen Essay über "Manhattan Transfer" schrieb, hat den Roman noch als verstörendes Werk gelesen: ein einziger "epischer Krankheitsbericht".
Vor allem verbinden sich mit "Manhattan Transfer" formale Errungenschaften der literarische Moderne: Montage der Szenen, filmische Schreibweisen, Kameraauge, dynamische Zoom-Effekte, Kubismus der Straßenszenen, Einblendungen von Werbung, Zeitungstexten und Schlagern, innere Monologe. Das alles klingt aber sehr viel aufregender, als es sich tatsächlich liest. Denn die meisten Seiten des Romans sind mit durchaus konventionellen Dialogen gefüllt.
Die Handlung ist nicht nur "fragmentiert" oder "dekonstruiert", es gibt eigentlich keine. Die Struktur des Geschehens ergäbe keinen Streckenplan mit einigen Haupt- und vielen Nebengleisen, sondern eher das Bild eines unübersichtlichen Rangierbahnhofs, auf dem unermüdlich die Waggons verschoben werden, von dem aber nie wirklich ein Zug abgeht. Auch die Sprache der Dialoge ist wenig fesselnd; sie hat das Niveau mittelklassiger Theaterstücke und wirkt öfter plakativ, weil der programmatische "moderne" Verzicht auf erläuternde Informationen und erzählerische Hintergründe dazu führt, dass die Dialoge selbst bisweilen überdeutlich sein müssen. Die grandiose Komik und die hintergründigen Sprachspiele des "Ulysses" liegen Dos Passos jedenfalls gänzlich fern. "Manhattan Transfer" ist ein humorloser Roman.
New York wird als riesiger Umschlagplatz dargestellt, als Zufluchtsort für Millionen Einwanderer, die von den Einwanderern der vorherigen Generation angefeindet werden. Es ist eine Stadt am Ende der Migrationskette, aus der es selbst kein Entrinnen gibt. Hier steht man immer mit dem Rücken zu irgendeiner Wand. Der tägliche Kampf um Geld, Liebe, Erfolg - oder auch nur um die nächste Mahlzeit - kennt viele Verlierer; nur bei wenigen verwirklicht sich der uramerikanische Mythos: vom Milchmann zum Millionär oder zumindest zum Gewerkschaftsführer, wie im Fall von Gus McNeil. Am Ende wird allen Schicksalen in diesem Roman nur eines attestiert: ihre Belanglosigkeit. Keine der Figuren rückt einem wirklich nahe, sie sind alle nur soziale Demonstrationsobjekte, Krabbeltiere unter der Metropolenlupe des John Dos Passos.
Selbst immer wieder auftretende Figuren des Romans (als Hauptfiguren möchte man sie kaum bezeichnen) wie der ehrgeizig-skrupellose Rechtsanwalt George Baldwin, der Journalist Jimmy Herf oder Ellen Thatcher, die wichtigste weibliche Gestalt, bleiben merkwürdig blass; sie haben keine Seele. Vielleicht war der Verzicht auf erzählerische Introspektion doch keine so gute Idee. Der Roman schleudert seine Figuren hinauf und hinab auf der sozialen Leiter, er überspringt die Jahre vom Jahrhundertbeginn über den Ersten Weltkrieg bis in die zwanziger Jahre, woraus sich oft beliebig wirkende Wechselfälle der Biographien ergeben. Nicht nur, dass man sich als Leser alle paar Seiten auf andere Figuren einstellen muss; auch die regelmäßig wiederkehrenden Figuren haben merkwürdige, unzureichend motivierte Sprünge in ihrer Identität, so dass man auch mit ihnen immer wieder neu beginnen muss.
In den Vereinigten Staaten steht John Dos Passos heute denn auch im Schatten von Hemingway, Faulkner oder Fitzgerald. Und vielleicht hat es nicht zufällig fast neunzig Jahre gedauert, bis die alte Übertragung des Romans von Paul Baudisch aus dem Jahr 1927 nun durch die ausgezeichnete neue Übersetzung Dirk van Gunsterens ersetzt wurde. Die alte Fassung war voller Unzulänglichkeiten; man findet neben einem völlig antiquierten Duktus Fehlgriffe der erstaunlichsten Art. Beim New Yorker Slang behalf Baudisch sich mit putziger deutscher Mundart: "Morjen, Mike, recht schön durchfroren, wa?" Es gibt Trouvaillen abgestorbenen Wortschatzes, etwa wenn eine Figur eine "Alligatorbirne" verzehrt - das war tatsächlich einmal die deutsche Bezeichnung für die Avocadofrucht. Ein "Banditenbackfisch" wiederum ist keine Speise, sondern Baudischs Bezeichnung für eine junge weibliche Kriminelle. "Weiber und Kinder" werden von den "gottverdammten Automoppels" überfahren, ein Mann wird "Flaschennase" genannt, offenbar hat er eine Neigung zum Alkohol; die Tram firmiert als "Planwagen". Diese wenigen Beispiele mögen zeigen, dass selten eine Neuübersetzung so überfällig und begrüßenswert war wie im Fall von "Manhattan Transfer". Wenn einen der Roman nicht wirklich überzeugt, dann weiß man jetzt: Es liegt nicht an der deutschen Fassung.
WOLFGANG SCHNEIDER
John Dos Passos: "Manhattan Transfer". Roman.
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Rowohlt Verlag, Reinbek 2016. 540 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main