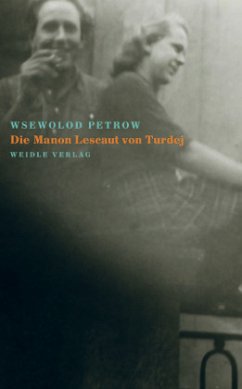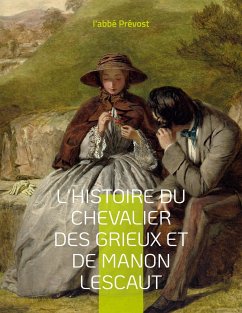Ein sowjetischer Spitalzug auf dem Weg von einer Front zu anderen. Darin ein Petersburger Intellektueller: Gepeinigt von Herzanfällen und Todesangst, liest er den Werther (auf deutsch). Aber in die Lektüre drängt sich die Geschäftigkeit der Militärärzte, Apotheker, Krankenschwestern um ihn herum. Es ist eine seltsame Gemeinschaft, hervorgebracht zwar vom Krieg, doch bestimmt von ganz alltäglichen Sorgen und kleinen Freuden:'Wir fuhren schon so lange, daß wir nach und nach die Vorstellung von der Zeit verloren hatten. Niemand wußte, wohin wir geschickt wurden. Wir fuhren von Station zu Station, als hätten wir uns verlaufen. Man hatte uns wohl vergessen.'Bei einem längeren Aufenthalt trifft er auf ein Mädchen, anders als alle anderen: Vera Muschnikowa, ruhelos und romantisch, grazil und ungestüm, und sie ist jederzeit zur Liebe bereit. Der Feingeist erliegt ihrem vulgären Zauber, erkennt in ihr seine 'sowjetische Manon' und erahnt damit bereits den dunklen Weg, den ihre Liebe nehmen wird.'Manon Lescaut von Turdej', entstanden 1946, erschien erst 60 Jahre später, im November 2006, in der Moskauer Zeitschrift 'Novyj Mir'.'Auf der Pritsche liegend, hatte ich mir die Liebe zu dieser sowjetischen Manon Lescaut ausgedacht. Ich hatte Angst davor, mir zu sagen, daß es nicht so war, daß ich mir nichts ausgedacht hatte, sondern tatsachlich alles vergessen und mich selbst verloren hatte und nur davon lebte, daß ich Vera liebte.Ich legte mich so auf die Pritsche, daß ich gleich den ganzen Waggon sehen konnte. Wo Vera auch auftauchte, ich konnte sie sehen. Wie ein Somnambuler drehte ich mich zu der Seite, wo sie war.'
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Als entzückende, "atmosphärisch-bukolische Trouvaille" würdigt Rezensent Jörg Plath Wsewolod Petrows nun auch auf Deutsch erschienene Liebesgeschichte "Die Manon Lescaut von Turdej" aus dem Jahre 1946. Ganz hingerissen liest er die Geschichte um einen namenlosen Arzt, der sich in einem Eisenbahnwaggon der Roten Armee nicht nur mit Goethes "Werther" und Rousseauismus beschäftigt, sondern sich auch in die junge Krankenschwester Vera verliebt, die ihm als Wiedergängerin der Manon Lescaut erscheint. Der Kritiker folgt Petrows eigensinnigem Helden bei seinen Versuchen der Kriegsgegenwart durch seine Träume vom 18. Jahrhundert zu entfliehen und seine Geliebte nach eben jenen Vorstellungen zu formen. Der russische Autor, der als Belletrist kaum in Erscheinung trat, habe aus seiner Novelle fast alle historischen Spuren - etwa Sowjetisches oder militärische Rituale - getilgt, berichtet der Rezensent. Auch wenn ihm die im Zweiten Weltkrieg spielende Geschichte bisweilen allzu sehr in die Vorstellungswelt des 18. Jahrhunderts abgleitet, kann Plath diese wunderbare Novelle nicht zuletzt aufgrund der exzellenten Übersetzung und des informativen Nachwortes nur unbedingt empfehlen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Weltliteratur, um sechs Jahrzehnte verspätet: Wsewolod Petrows Novelle "Die Manon Lescaut von Turdej".
Von Kerstin Holm
Die Mottenkiste der russischen Kultur fördert noch immer Juwelen zutage. So die zartbittere Kriegserzählung "Die Manon Lescaut von Turdej" des Leningrader Kunstwissenschaftlers Wsewolod Petrow (1902 bis 1978), eine der schönsten Liebesnovellen des zwanzigsten Jahrhunderts, die in Petrows Nachlass verstaubte, bis die Zeitschrift "Nowyj mir" sie 2006 publizierte. Dank der in Frankfurt lebenden Literatenfamilie Oleg Jurjew, Olga Martynowa und ihrem Sohn Daniel Jurjew erscheint im Weidle Verlag jetzt eine asketisch-edle deutsche Ausgabe, für die Daniel Jurjew die vorzügliche Übersetzung beigesteuert hat und seine Eltern die ebenso knappen wie wichtigen Kommentare.
Auch Petrow, der einer vornehmen Petersburger Familie entstammte, war ein Kulturvermittler. Der strenge Mentor vieler widerständiger Intellektueller hatte seinen einzigen belletristischen Text über einen Lazarettzug der Sowjetarmee im Nachkriegsjahr 1946 verfasst, als Antwort auf die klassisch sowjetische Spitalzuggeschichte "Weggefährten" von Vera Panowa, die im selben Jahr erschienen war. Sowohl die "Weggefährten" als auch Petrows "Manon" schildern eine Abteilung aus Ärzten, Sanitätern, Krankenschwestern, die von einem russischen Kriegsschauplatz zum andern unterwegs sind, mit ihren menschlichen Schwächen von männlicher Trunksucht bis zu weiblicher Koketterie. Doch während bei der Journalistin Panowa die Figuren im Augenblick der Feindberührung heroisch über sich hinaus- und zusammenwachsen, blendet Petrow alle kriegsrelevanten Einzelheiten wie Orte, Dienstgrade, Bewaffnung oder Kampfmoral aus, als stellte er sein Objektiv absichtlich unscharf.
Petrow kommt zur Essenz der Situation durch die kulturelle Fokussierung. Sein von Erstickungsanfällen verfolgter Ich-Erzähler liest den "Werther" auf Deutsch, was damals, nach dem Nazi-Einmarsch, doppelt undenkbar war. An der blassen jungen Krankenpflegerin, in die er sich verliebt, bewundert er die raffiniert-temperamentvollen Züge des achtzehnten Jahrhunderts, weshalb er glaubt, durch ihr Mädchengesicht hindurch auch in das der untergangsgeweihten Marie Antoinette zu blicken.
Sein Gefühl überfällt den Eigenbrötler unvermittelt: Er offenbart sich der Kindfrau, macht ihr Avancen. Er sieht in ihr eine tanzende Flamme, selbst Rücksichtslosigkeit und Betrügereien findet er an ihr nur bezaubernd. Ihr Herz gewinnt er (auch weil er ihr trotz gegenteiliger Geständnisse nicht verfällt) an einer Haltestelle namens Turdej - ein altslawisches Toponym, das in seinen Ohren französisch klingt wie ein russifiziertes Tourdeille. Dort in einer winzigen Hütte einquartiert, genießt er, hinter seinem Rücken als Narr verspottet, beengte Zweisamkeit mit seiner Manon Lescaut.
Wsewolod Petrow versteckte seine Prosadichtung nicht. Er zeigte sie Bekannten und las Freunden daraus vor. Er versuchte nur nie, sie zu veröffentlichen - wissend, dass für die Gesellschaft, die ihn umgab, seine Weltwahrnehmung inakzeptabler war als die eines Marsmenschen. Petrows Manon betrügt auch den Helden; doch als sie bei einem Bombenangriff stirbt, rennt er los ins Nichts, um wenigstens dort sie noch einmal zu spüren. Inzwischen hat sich die sowjetische Lagergesellschaft aufgelöst. Und Petrows höchstwahrscheinlich selbsterlebte Geschichte ist, wie zuvor schon Nikolai Lesskows "Lady Macbeth von Mzensk" oder Iwan Turgenjews "König Lear der Steppe", ein zwar mikroskopisch kleiner, aber unzerstörbarer Teil der Weltkultur geworden.
Wsewolod Petrow: "Die Manon Lescaut von Turdej". Roman.
Aus dem Russischen von Daniel Jurjew. Weidle Verlag, Bonn 2012. 125 S., br., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main