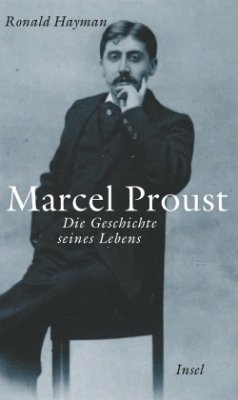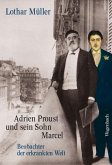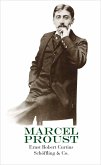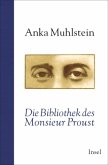Ronald Hayman geht in seiner Proust-Biographie einen neuen Weg. Er stellt die äußeren Bedingungen für jenen 'inneren Zustand' dar, in dem Proust die »Recherche« schreiben konnte. Hayman macht dazu als erster von dem in Deutschland nur wenig bekannten gesamten Briefwechsel Prousts Gebrauch.

Gartenrose im Knopfloch: Ronald Hayman auf den Spuren des ewigen Sohnes Marcel Proust / Von Joseph Hanimann
Etwas Entscheidendes fehlt dieser Biographie, die seit ihrer englischen Erstpublikation vor zehn Jahren bereits von zwei neuen biographischen Arbeiten Ghislain Diesbachs und Jean-Yves Tadiés überrundet wurde. Es fehlt das passend vorangestellte Motto. Zum Beispiel jene Stelle aus "Contre Sainte-Beuve", in der Proust klarstellt, ein Buch entstehe aus einem anderen Ich als dem, "das sich in unseren Gewohnheiten, in unserem Gesellschaftsleben, in unsere Lastern kundtut". Mag diese Aversion gegen das Literaturverständnis eines Sainte-Beuve auch Teil der Tarnstrategie sein, mit der Proust die Faktizität der zahlreich aus dem eigenen Leben ins Werk eingeflossenen Bestandteile zu neutralisieren suchte, so darf sie doch bei der Lektüre sowohl des Romanzyklus wie der Lebensgeschichte nicht vergessen werden. Jedenfalls bleibt Haymans Arbeit, die durch die zahlreich angeführten Briefstellen, Zeitdokumente, Zitate aus dem Frühroman "Jean Santeuil" und Bekundungen des Erzähler-Ichs in der "Recherche" auf das Alltagsleben Prousts abzielt, der englischen Biographietradition verpflichtet, weitab vom Prinzip der Werkimmanenz. Was auch bedeutet, daß die kulturgeschichtlichen Zahnräder und psychologischen Präzisionsfedern hier vorzüglich ineinandergreifen.
Neue Erkenntnisse gab es nach der fast unüberschaubar gewordenen Proust-Forschung, nach Tadiés minutiöser neuer Werkedition bei Gallimard vor elf Jahren und nach Philip Kolbs auf einundzwanzig Bände angewachsener Proust-Korrespondenz ohnehin nicht zu erwarten. Haymans Buch bietet aber Ein- und Umstiegsmöglichkeiten für Proust-Leser unterschiedlichen Kompetenzgrades: Den Anfänger befördert es vom Leben zum Werk, den Kenner setzt es manchmal in der unerwarteten Kehrschleife ab, wo die Realität die Literatur noch übertrifft.
Anfang Juli 1896 etwa lernt der fünfundzwanzigjährige Proust im Haus der Princesse de Wagram die wunderschöne Gräfin Greffulhe kennen, eine Cousine des literarischen Dandys Robert de Montesquiou, die acht Jahre älter ist als er. Aus Angst vor Verlegenheit möchte der junge Autor ihr nicht vorgestellt werden, schwärmt aber in einem Brief an den Freund Montesquiou von der "polynesischen Anmut" mit "malvenfarbenen Orchideen" in der Frisur. Die erotische Phantasie, in der Reminiszenzen an Prousts Mutter anklingen, führte zur Erzählung "Der Gleichgültige". Eine adelige Dame, die mit Hilfe von Orchideen ihrem Haar einen "polynesischen Reiz" verleiht, verliebt sich da in einen geistig wie physisch belanglosen Mann aus der Mittelschicht um so mehr, als dieser ihr gegenüber gleichgültig bleibt. Dasselbe Motiv taucht später in einer anderen Geschichte wieder auf, die als "Melancholische Sommertage in Trouville" ins Romanfragment "Jean Santeuil" einging. Aus dieser Identifizierung mit dem weiblichen Sehnen nach einem so reizlosen wie lieblosen Mann entspringt ein wichtiges literarisches Motiv des homosexuell sich gerade determinierenden Autors Proust. Hayman präsentiert diesen Prozeß der geschlechtsverkehrenden Transposition in Form einer biographischen Metaerzählung aus Proust-Zitaten und reichlichen Zeitzeugnissen über die wahre Gräfin Greffulhe.
So ist es auch nicht verwunderlich, daß der selbstbewußte Biograph sich mit dem diskreten Herausmeißeln einzelner Charakterzüge seiner Figur aus dem umfangreichen Material nicht begnügt. Das besonders herausgearbeitete Motiv der Willensschwäche Marcel Prousts etwa wird klar als jener"irreparable psychische Schaden" dargestellt, den die Eltern wohlmeinend dem Sohn zufügt hätten: der strenge Adrien Proust durch seine ständigen Ermahnungen und die hochsensible Mutter Jeanne, die seit der entbehrungsreichen Schwangerschaft während den Tagen der Pariser Commune Schuldgefühle gegenüber dem schwächlichen Erstgeborenen hegte, durch ihre zärtliche Nachgiebigkeit. Die einzige Stärke, mit welcher der junge Mann sich durchsetzen und die Zuwendung seiner Umgebung gewinnen konnte, war das Schwachsein, das Vorzeigen seiner Asthmaanfälle und die lustvolle finanzielle Abhängigkeit. Der für überzogene Blumengeschenke und Trinkgelder bekannte Proust listete bei seinen Reisen der Mutter brieflich oft Busfahrgeld und andere Kleinigkeiten auf - "ich wollte einfach, daß Du weißt, was ich ausgebe", schrieb er im Herbst 1899 aus Venedig.
Gleichzeitig war ihm die Abhängigkeit aber auch peinlich, zumal die Eltern seinen mondänen Müßiggang in den Salons mißbilligten und abends um sieben die Pferde ausspannen ließen. Vom Vorstadthaus des Onkels in Auteuil mußte er für die Abendeinladungen oft, Krawatte und Frackschöße unter dem Mantel notdürftig verbergend, den Omnibus in die Stadt nehmen und sich mit einer im Garten abgeschnittenen Rose als Knopflochblume begnügen. Dieser geradezu ritualisierte Status materieller Unselbständigkeit prägte das gesamte Wirkungsfeld des schon schriftstellernden, reichlich lesenden und Ruskin übersetzenden dreißigjährigen Bürgersohns. In der elterlichen Wohnung hatte er kein eigenes Arbeitszimmer, schrieb bald im Eßzimmer, bald im Rauchzimmer, meistens aber im Bett und war so jahrelang noch den Launen der Eltern ausgesetzt - ein Krankheitsmuster, das in seiner "häuslichen Ohnmacht", wie Hayman anmerkt, dem Kafkas nahekam.
Es spiegelt aber auch die später als Motiv über die ganze "Recherche" sich ausbreitende Frustration, durch die Nichtzugehörigkeit zum Adel den Müßiggang nicht als selbstverständlich erleben zu können, ihn gleichsam kunstschöpferisch erarbeiten zu müssen. Prousts Faszination für den Adel geht Hayman zufolge sogar so weit, daß der Umgang mit Fürsten und Herzögen ihm helfen sollte, sein eigenes Halbjudentum abzustreifen und damit den gesellschaftlichen Erfolg des brillianten Literaturjournalisten Charles Haas - Vorbild für die Romanfigur Swann - zu wiederholen. Mochte der Schriftsteller auch die frühe Sensibilisierung für Theater, Musik und Literatur ausschließlich der Kunstliebe seiner jüdischen Mutter und Großmutter verdanken, so empfand er laut Hayman keinerlei besonderen Stolz auf diese Herkunft. Wohl war er während der Dreyfus-Affäre unmißverständlich für die Rehabilitierung des jüdischen Hauptmanns und saß beim dreiwöchigen Prozeß gegen Zola täglich im Gerichtssaal. Das Judentum kommt aber weder in den Romanen noch in den Briefen als Thema vor, und der Biograph Hayman läßt sich zu Mutmaßungen verleiten über die Anziehungskraft blondhaariger junger Adeliger für den dunkelhäutigen, eher orientalisch aussehenden Proust: ein Motiv, das sich in der "Recherche" in der Figur des blonden, hellhäutigen Marquis Robert de Saint-Loup niedergeschlagen haben soll. Solche beiläufig eingestreuten und auch nicht weiter ausgeführten Hypothesen gehören zu den entbehrlichsten Stellen dieser Biographie. Dies um so mehr, als sie sich manchmal mit Banalität kreuzen wie in jener Spekulation über die Autofahrt: Wäre das Automobil zu Prousts Zeiten eine Selbstverständlichkeit gewesen, schreibt Hayman, hätten die Kirchtürme, Belfriede und alten Gärten zwischen Méséglise und Guermantes sich womöglich nie zu einem neuen Bewußtseinsraum aus schneller Bewegungszeit geordnet.
Am gelungensten bleibt diese Biographie dort, wo sie Prousts OEuvre weiträumig aus dem Kontext hebt, wie man einen Schatz aus trübem Wasser hebt. Wenn in den informativen Einschüben der Wohnungskomfort und der Straßenverkehr im Paris der frühen Dritten Republik, die Zusammensetzung der Armee zur Zeit der Dreyfus-Affäre oder die Pariser Salonwelt der Jahrhundertwende dargestellt wird, so erklärt das literarisch zwar nichts, trifft aber das biographisch gesteckte Ziel. Und die langsame Mutation vom hypochondrisch kränkelnden Salongänger zum bettlägrigen Langstreckenläufer des Schreibstifts, der ab 1917 in trotzigem Selbstvertrauen die Worte "Krankheit", "Sterben" und "Tod" praktisch gleichsetzt, läßt hinter der scheinbaren Willensschwäche überzeugend die phänomenale Schaffenskraft aufscheinen. Die Perspektive bleibt dabei konsequent die des Lebensbegleiters, nicht des Werkdeuters, und diskret zeigt die Biographie in den letzten Kapiteln durch die Zitate ihren hypothetischen Standort an: den an der Seite von Prousts langjähriger Hausangestellten Céleste Albaret, die später so viele Alltagsdetails zu erzählen wußte. Dank der Titanenarbeit des Übersetzers geht nicht nur der Übergang zwischen englischer Vorlage und noch unübersetzten französischen Originalbriefen reibungslos vonstatten, sondern wurde auch der bibliographische Anhang und manche Quellenangabe im Text aktualisiert. Die Biographie wird damit zugleich zum lesefreundlichen Nachschlagewerk für Proust-Liebhaber und solche, die es werden wollen.
Ronald Hayman: "Marcel Proust - Die Geschichte seines Lebens". Aus dem Englischen übersetzt von Max Looser. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2000. 840 S., geb. 78,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Joseph Hanimann hat einiges auszusetzen an dieser Biografie, obwohl er schon im Vorfeld eingeräumt hat, dass neue Erkenntnisse nach der "unüberschaubar gewordenen Proust-Forschung" sowieso nicht zu erwarten gewesen seien. Auch liege die englische Erstpublikation zehn Jahre zurück und sei bereits von zwei neueren biografischen Arbeiten überrundet worden. Dennoch bietet das Buch nach Rezensentenmeinung "Ein- und Umstiegsmöglichkeiten für Proust-Leser unterschiedlichen Kompetenzgrades". Sein bibliografischer Anhang und Quellenangaben im Text mache es sogar zum "lesefreundlichen Nachschlagewerk für Proust-Liebhaber", was auch der "Titanenarbeit" des Übersetzers geschuldet sei. Aber Hanimann hat auch manch haarsträubendes Detail aus dem Buch zu bieten, zum Beispiel, dass der "dunkelhäutige, eher orientalisch aussehende Proust", dessen Mutter Jüdin war, von blonden, hellhäutigen Adeligen besonders angezogen wurde. Und dass der Umgang mit Fürsten und Herzögen ihm hätte helfen sollen, sein eigenes "Halbjudentum" abzustreifen. Da scheint doch ein bisschen viel veraltete Rassentheorie ins Hirn des englischen Biografen gesickert zu sein.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH