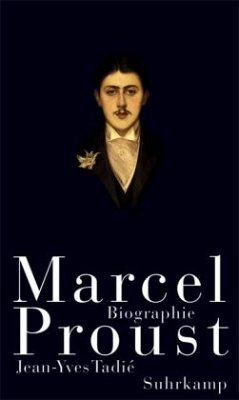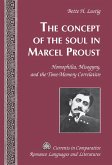Die "Biographie des Werkes" ist die einzig sinnvolle Aufgabe für einen Proust-Biographen. Mit diesem Leitfaden folgt Jean-Yves Tadié - Kenner und wohl wichtigster Herausgeber des Proustschen Gesamtwerkes - der Intention Prousts, der 1921 in seinem Aufsatz über Baudelaire betont, bei einer Biographie gehe es um das Warum und das Wie, nicht um das Was.
Bei Tadié sind folglich die äußeren Lebensumstände und -zeugnisse, einschließlich der Korrespondenz, nur Belege und Mittel, um das "innere Leben", das, was Proust wußte, dachte, empfand, interpretierend zu erschließen. Die Darstellung fließt dabei nicht immer exakt linear. Sie reflektiert auch die Bruchstellen und registriert bewertend die Details von Belang und die oft retardierenden Bedeutungen der Ereignisse. Es ergibt sich ein Puzzle von Personen, Orten und Motiven. Jedes einzelne der Teile gleicht einer Miniatur, bildet ein eigenständiges Porträt, um sich schließlich in ein Gesamtbild zu fügen. Dieses mikrologische Verfahren bietet alles, was man über Proust wissen kann, alles Wissenswerte, was zum Verständnis der Gestalt des Schriftstellers und seines Werkes beiträgt.
Bei Tadié sind folglich die äußeren Lebensumstände und -zeugnisse, einschließlich der Korrespondenz, nur Belege und Mittel, um das "innere Leben", das, was Proust wußte, dachte, empfand, interpretierend zu erschließen. Die Darstellung fließt dabei nicht immer exakt linear. Sie reflektiert auch die Bruchstellen und registriert bewertend die Details von Belang und die oft retardierenden Bedeutungen der Ereignisse. Es ergibt sich ein Puzzle von Personen, Orten und Motiven. Jedes einzelne der Teile gleicht einer Miniatur, bildet ein eigenständiges Porträt, um sich schließlich in ein Gesamtbild zu fügen. Dieses mikrologische Verfahren bietet alles, was man über Proust wissen kann, alles Wissenswerte, was zum Verständnis der Gestalt des Schriftstellers und seines Werkes beiträgt.

Jean-Yves Tadié lässt auf den 1200 Seiten seiner Marcel-Proust-Biographie das Leben des Schriftstellers zur Materialsammlung seines Werkes zusammenschrumpfen
Anfang 1922 bietet der Autographensammler Jacques Doucet Proust 7000 Francs für die Fahnen und das ursprüngliche Manuskript des zweiten Teils von "Sodom und Gomorrha". Proust ist unschlüssig, ob er sich auf dieses Angebot einlassen soll, nicht wegen des geringen Betrages, sondern weil ihn die Vorstellung schreckt, seine Manuskripte eines Tages in einer öffentlichen Bibliothek zu sehen. "Was mich zögern lässt, ist, dass die Bibliotheken dieses Herrn nach seinem Tod Staatseigentum werden sollen. Der Gedanke, dass es . . . irgendwem gestattet sein wird, meine Manuskripte durchzusehen, sie mit dem endgültigen Text zu vergleichen, daraus Folgerungen über meine Arbeitsweise, die Entwicklung meines Denkens usw. zu ziehen, die immer falsch sein werden, ist mir jedoch nicht sehr angenehm."
Dennoch vernichtet Proust seine Notizbücher, die berühmten Cahiers, ebenso wenig wie die Maschinenabschriften und die verschiedenen Sätze der Fahnen, allesamt mit Korrekturen und Zusätzen versehen, die sich, wenn der Platz nicht reicht, auf einer Rolle aneinandergeklebter Zettel fortsetzen. Bis auf 32 Hefte, die auf Prousts Wunsch während des Krieges verbrannt worden sind, blieb alles erhalten. Warum? Wie so oft soll erst nach dem Tod vernichtet werden, was man zu Lebzeiten noch braucht, solange man lebt, ist alles noch Material. Insbesondere bei Proust, der immerzu um- und neu schreibt, ergänzt, einfügt und streicht und ganze Bände, wenn sie aus dem Satz kommen, neu komponiert. "Von 20 Zeilen des ursprünglichen Textes (der im übrigen durch einen neuen ersetzt wird) bleibt keine einzige übrig", schreibt Proust 1913 über die Druckfahnen von "In Swanns Welt". Was für Verleger, Drucker und Korrektoren oft genug Anlass zur Verzweiflung war, ist für uns Leser ein Glück, erlaubt der Vergleich der verschiedenen Fassungen, die, da Proust sich nicht von ihnen zu trennen vermochte, erhalten blieben, doch das, was Proust befürchtet hatte: Rückschlüsse zu ziehen auf die Denk- und Arbeitsweise des Autors und die Rekonstruktion der Genese des Werks.
Dieser hat sich der Proust-Kenner und Herausgeber der vierbändigen Pléiade-Ausgabe von "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit", Jean-Yves Tadié, verschrieben. In seiner 1996 bei Gallimard erschienenen voluminösen Biographie, die jetzt auch auf Deutsch vorliegt, verspricht er, die Biographie des Werks nachzuzeichnen, was nichts anderes bedeuten kann, als das Leben Prousts, das er erzählen will, vom Ende her zu lesen, von diesem Werk aus, das erst unmittelbar vor Prousts Tod als Ganzes dasteht. Und von dem aus das Leben Prousts erst die Stringenz und Logik bekommt, die ihm sonst fehlten: Alles, was er erlebt, gedacht und gefühlt hat, alles, was er geschrieben hat, läuft auf dieses Werk zu und geht in es ein.
Diese These klingt gut, ist aber auch trivial. Worüber soll ein Schriftsteller schreiben, wenn nicht über das Vertraute? Proust, der immer von sich sagte, er könne nichts erfinden, schöpft verständlicherweise aus seinem Leben - zumal es ja sein Leben ist, das er, mit den Transformationen, Verdichtungen, Zuspitzungen und Weitschweifigkeiten, die die Schönheit von "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" ausmachen, beschreibt. Aber erst nachdem er sowohl die Arbeit an dem autobiographischen Fragment "Jean Santeuil" als auch die an dem Hybriden aus Roman und ästhetischer Theorie "Gegen Sainte-Beuve" aufgegeben hat und Erzählerstimme, Stil und Gesamtkonstruktion des neuen Romans gefunden sind, also etwa um die Jahreswende 1908/1909, lebt Proust nur noch für sein neues Werk.
Und ab diesem Punkt beginnt der Ansatz von Tadié, der, insbesondere was Kindheit und Jugend betrifft, überstrapaziert wirkt, da er immerzu Parallelismen zum späteren Werk aufbaut, ohne seinen Eigen-, das heißt ursprünglichen Erlebniswert darzustellen, plausibler zu werden. Er zeigt, wie Proust sein Leben umorganisiert und alles dem Schreiben unterordnet. Er geht fast nur noch aus, um Bekannte, deren Aussehen, Gewohnheiten, Kleidungsstil, Gestik und Art zu sprechen er seinen Figuren zugrunde legt, wiederzusehen; er besticht die Kellner im "Ritz", um alles über Garderoben, Tischordnungen, Menüfolgen zu erfahren, die er ausführlich schildern wird; er sucht Etablissements von zweifelhaftem Ruf auf, um, versteckt, der Ausübung sadomasochistischer Sexualpraktiken beizuwohnen; und während des Krieges streift er durch das dunkle Paris, beobachtet die herannahenden deutschen Bomber und die aufsteigende französische Flugabwehr und ist fasziniert von den Riesenscheinwerfern, die den nächtlichen Himmel nach den Flugzeugen des Feindes absuchen.
Es gibt nichts, was nicht Eingang finden könnte ins Werk. Er experimentiert, er recherchiert. Er lebt, um zu schreiben. Aber was hat diese Wende hervorgerufen? Auch wenn Tadié mit dem Mythos aufräumt, Proust habe, bevor er an sein Hauptwerk ging, das Leben eines Müßiggängers geführt, einfach indem er die große Anzahl der journalistischen Arbeiten, die Proust in seinen Zwanzigern und Dreißigern neben den beiden Romanfragmenten schrieb, nicht übergeht, sondern ebenso minutiös auswertet wie Prousts Lektüre und seine Beschäftigung mit Kunst und Architektur, so ist die Verschiebung des Schwerpunktes in dem Verlust zu suchen, den Proust am 26. September 1905 erleidet: an diesem Tag stirbt seine Mutter. Ihr Tod lässt ihn erstarren. Er löst in ihm einen Zustand aus, der dem seiner Mutter ähnelt, als sie 1903 ihren Mann verliert. Was Proust damals von ihr sagt, widerfährt ihm nun selbst: "Und nun, wo sie ihres Sinns und ihrer Daseinssüße beraubt worden sind, kommen sie alle, jede in einer anderen Gestalt und wie böse, quälsüchtige Feen, und halten ihr das Elend vor Augen, das sie niemals mehr verlassen wird."
Proust fährt, nach den ersten Wochen der Lähmung, drei Monate zur Kur, und es scheint, dass sich in dieser Zeit etwas in ihm verschoben hat, was seinen Blick auf die Welt von Grund auf ändert. Er beschreibt den Zustand, in dem er sich nach seiner Rückkehr befunden haben muss, in der "Wiedergefundenen Zeit", wo der Erzähler nach langer, krankheitsbedingter Abwesenheit nach Paris zurückkehrt und die ihm von früher vertrauten Menschen kaum mehr wiedererkennt - wie auch sie ihn nicht mehr erkennen. Es ist nicht das Älterwerden, auch wenn Proust immer wieder das abrupte Altgewordensein seiner Freunde beschreibt, allein, sondern die Distanz, mit der er zurückkehrt. Es geht ihm nichts mehr nah als das, was er in sich eingeschlossen hat, die Erinnerung an das verlorene Glück.
Das letzte Drittel, in dem Tadié diese Verwandlung Prousts dicht und einfühlsam beschreibt, ist der stärkste Teil der Biographie. Hier ist er seinem Ziel, die Biographie des Werks zu schreiben, ganz nahe - denn dieses Werk ist jetzt in ersten Teilen sichtbar, es wächst zu der Gestalt heran, in der wir Leser es kennen, und es überwuchert das Leben. Und Tadié ist, im Vergleich der Fassungen, dem Hinweis auf wesentliche Ergänzungen, sichtlich in seinem Element.
Das lässt sich leider nicht von allen Passagen der Biographie behaupten. Geradezu quälend liest sich die Vorbemerkung mit ihrem antiquierten Pluralis Majestatis, in der Tadié verspricht, man werde "kein einziges Faktum ohne Bedeutung lesen" - woran er sich dann nicht hält. Denn was, nur zum Beispiel, soll man mit dem folgenlosen Satz beginnen, dass Proust auf einer Sonntagsmatinee dabei beobachtet wurde, "wie er sich mit Kleingebäck vollstopft"? Und was von dieser Beschreibung halten: "Vom Haus der Bénacs, das heute immer noch steht, wird Marcel die Aussicht auf das Meer betrachten, vor der Sonne geschützt durch einen Schirm, den Reynaldo hält"? Das sind Nichtigkeiten, die ermüden und von der Hauptsache ablenken: der Erzählung des Lebens und der Schöpfung des Werks. Es gibt Kapitelanfänge, die geradezu absurd anmuten, wie "Herbstbeginn 1893": "Nach Paris zurückgekehrt, setzt Marcel seine glanzvolle militärische Laufbahn fort: er soll sich auf ein Offiziersexamen vorbereiten, für das er seinen Vater um Fürsprache bei Dr. Kopff bittet. Vor allem bemüht, Montesquiou zu gefallen, weiht er diesen in das Projekt eines Artikels ein . . ." Von der Fortsetzung der militärischen Laufbahn, die auch nie "glanzvoll", sondern immer höchst bescheiden war, ist anschließend nie wieder die Rede. So wird der Leser häufig mit einer irrelevanten Information stehengelassen - und wünschte, das Buch hätte ein Lektorat erfahren, das solche Nichtigkeiten gestrichen und den Stil überarbeitet hätte.
Auch im Anmerkungsapparat finden sich zahlreiche Fehler und stilistische Mängel - so ist weder das Geschlecht von "Sanftmut" noch "Abscheu" bekannt, ist von "Sympathie der Bewunderung" die Rede und wird Frédéric Passy als "militanter Pazifist" bezeichnet. Proust-Leser sind verwöhnt, und diese Biographie, das ist klar, richtet sich mit ihrer Detailfülle und ihren Tausenden von Anmerkungen an Proustianer. Gerade diese aber lieben Genauigkeit, Humor und einen süchtig machenden Stil - und dürfen, mit Recht, auch von Proust-Biographien Subtilität der Komposition und Schönheit der Sprache verlangen. Da es bis zum Erscheinen von Tadiés Werk auf Deutsch zwölf Jahre gedauert hat, hätte eines mehr für eine gründliche Überarbeitung keinem weh getan. So ist nun leider etwas Unfertiges erschienen, kein Grund zu ungetrübter Freude - für alle Proustianer aber sicher dennoch ein Muss.
BETTINA HARTZ
Jean-Yves Tadié: "Marcel Proust". Biographie. Übersetzt von Max Looser. Suhrkamp 2008, 1266 Seiten, 55 Abbildungen, 68 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Für Thomas Laux bedeutet Jean-Yves Tadies Biografie ein "Meilenstein" in der Proustforschung, auch wenn sie nicht alle Fragen erschöpfend beantwortet, wie er feststellen muss. Dem Autor, vom Rezensenten als besonderer Kenner Prousts gerühmt, geht es vor allem um die Entstehung und die spezifische Ästhetik des Proustschen Werks, wie Laux betont. Ohne allzu stoisch die "allseits sanktionierten" Stationen der Biografie des Schriftstellers abzuschreiten, zeige sich Tadie sensibel für wichtige "Nebenschauplätze", zeichne ein anschauliches Epochenbild und stelle die gesellschaftliche Atmosphäre von Prousts Umfeld eindrücklich nach, lobt der Rezensent. Ein bisschen wundert er sich über die betonte Distanz, die der Autor zur Schau trägt. Bei der Darstellung der sexuellen Disposition beispielsweise notiert Laux zwar dankbar die Zurückhaltung gegenüber wohlfeiler psychologischer Erklärungen und spekulativer Ausführungen, ein bisschen weniger Indifferenz hätte er sich dennoch erhofft. Dafür scheint dem insgesamt dennoch sehr eingenommen wirkenden Rezensenten die im letzten Drittel des Bandes vorgelegte Darstellung der Produktionsumstände von Prousts Hauptwerk, "A la recherche du temps perdu" wieder außerordentlich informativ und erhellend.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Wer etwas über das Leben des Schriftstellers erfahren will, kommt um diese Biographie nicht herum.« Olaf Kistenmacher literaturkritik.de 20180214