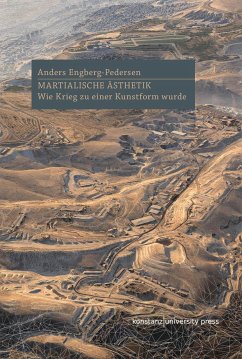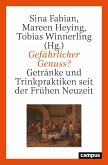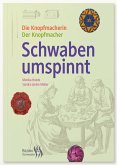Das einundzwanzigste Jahrhundert ist Zeuge einer Militarisierung der Ästhetik, bei der Militäreinrichtungen die kreative Weltgestaltung der Kunst vereinnahmen und sie mit den zerstörerischen Kräften der Kriegsführung verschmelzen.In Martialische Ästhetik untersucht Anders Engberg-Pedersen die Ursprünge dieser Allianz und zeigt auf, dass die heutige kreative Kriegsführung lediglich eine historische Entwicklung fortsetzt. Die Entstehung der Kriegsästhetik geht auf eine Reihe von Erfindungen, Ideen und Debatten im achtzehnten und frühen neunzehnten Jahrhundert zurück. Schon damals übernahmen militärische Denker und Erfinder Ideen aus dem Bereich der Ästhetik über das Wesen, den Zweck und die Kraft der Kunst und formten sie zu innovativen Militärtechnologien und -theorien um. Krieg wurde nicht nur als praktische Kunst, sondern auch als ästhetische Form konzipiert. Das Buch zeigt, wie militärische Diskurse und frühe Kriegsmedien wie Sternkarten, Horoskope und das preußische Kriegsspiel mit Ideen von Kreativität, Genie, Philosophie und ästhetischen Theorien (von Denkern wie Leibniz, Baumgarten, Kant und Schiller) verwoben wurden, um die Entstehung einer kriegerischen Ästhetik nachzuzeichnen. Mit seinem historischen und theoretischen Ansatz bietet Martialische Ästhetik eine neue Perspektive für das Verständnis des Krieges im einundzwanzigsten Jahrhundert.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
"Bahnbrechend" findet Rezensent Ingo Arend Anders Engberg-Pedersens Essay zur sonst wenig beachteten "Kernfusion" von Krieg und Ästhetik, die der dänische Literaturwissenschaftler historisch und philosophisch aufrollt. Die Darstellung spanne dabei einen Bogen von astrologischen Modellen böhmischer Feldherren über ein Kriegs-Brettspiel für die preußische Armee bis hin zur 3-D-Simulation des US-Militärs, das die gesamte Welt als "Kriegszone" imaginiert. Wie der Autor dabei "messerscharf" und frei von Moralisierung zeigt, dass der künstlerische "Modus der Fiktion" für Kriegszwecke missbraucht werde und dass letztlich von einer Verwischung der "Trennlinie zwischen Zivilisation und Barbarei" zu sprechen sei, erntet vom Kritiker den höchsten Respekt. Eine "brillante Studie", die den Kritiker auch in ihrer souveränen Verquickung von Philosophie, Literaturwissenschaft, Kulturgeschichte und Militärstrategie besticht und die für ihn ex negativo für die "Kernkompetenz" der Kunst einsteht: den Entwurf alternativer Welten, mahnt Arend.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Engberg-Pedersens brillante Studie ist ein bahnbrechender Beitrag zur Aufklärung über die Militarisierung des Denkens und einer Instrumentalisierung der Kunst. Luzide und souverän amalgamiert er darin Philosophie, Literaturwissenschaft, Kulturgeschichte und Militärstrategie.« (Ingo Arend, taz, 29.03.2025)