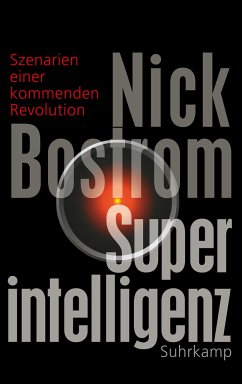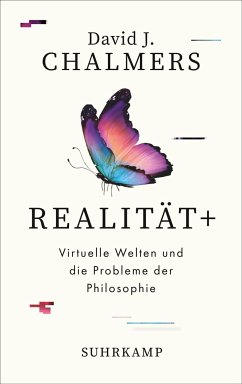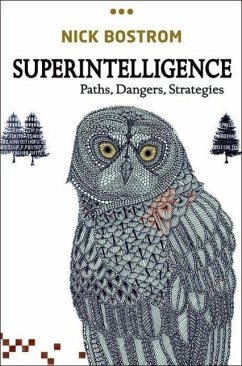Maschinenwinter - Wissen, Technik, Sozialismus
Eine Streitschrift
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
10,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Es sind bekanntlich nicht die Maschinen, die Maschinen einstellen, sondern Menschen, die Maschinen bauen und einsetzen. Daher ist es nicht länger hinzunehmen, daß Maschinen die Lebensverhältnisse zunehmend verschlechtern, obwohl sie im Ursprung dazu gedacht waren, diese zu verbessern. Selbst in den reichsten Ländern ist von Lebenserleichterung durch Technik nicht mehr viel zu merken: Der kreative Computerdienstleister fristet das Dasein eines biblischen Tagelöhners; die High-Tech-Ärztin schreibt Gutachten über die Almosenberechtigung kranker Unterstützungsempfänger; jede Modernisierun...
Es sind bekanntlich nicht die Maschinen, die Maschinen einstellen, sondern Menschen, die Maschinen bauen und einsetzen. Daher ist es nicht länger hinzunehmen, daß Maschinen die Lebensverhältnisse zunehmend verschlechtern, obwohl sie im Ursprung dazu gedacht waren, diese zu verbessern. Selbst in den reichsten Ländern ist von Lebenserleichterung durch Technik nicht mehr viel zu merken: Der kreative Computerdienstleister fristet das Dasein eines biblischen Tagelöhners; die High-Tech-Ärztin schreibt Gutachten über die Almosenberechtigung kranker Unterstützungsempfänger; jede Modernisierung der Produktion bedeutet Massenentlassungen statt Arbeitszeitverkürzung. Aber nicht einmal den Anschluß an diese noch vergleichsweise luxuriösen Formen des Jammers gönnt man den ärmeren Gegenden; dorthin wird bloß alles ausgelagert, was man mit den Lohnabhängigen des Westens einstweilen noch nicht machen kann. Wie soll man die Maschinen stürmen, um sie in Besitz zu nehmen? Kann man die moderne Arbeitsteilung beibehalten, aber die Hierarchien, Abhängigkeiten und das Unrecht loswerden, die an ihr kleben? Was haben die Industrie, der von ihr geschaffene Reichtum und der von ihr ausgeworfene Schmutz mit Freiheit zu tun? Der Essay Maschinenwinter riskiert eine literarische, politische, polemische und spekulative Phantasie darüber, wie man mit Technik Geschichte machen könnte.