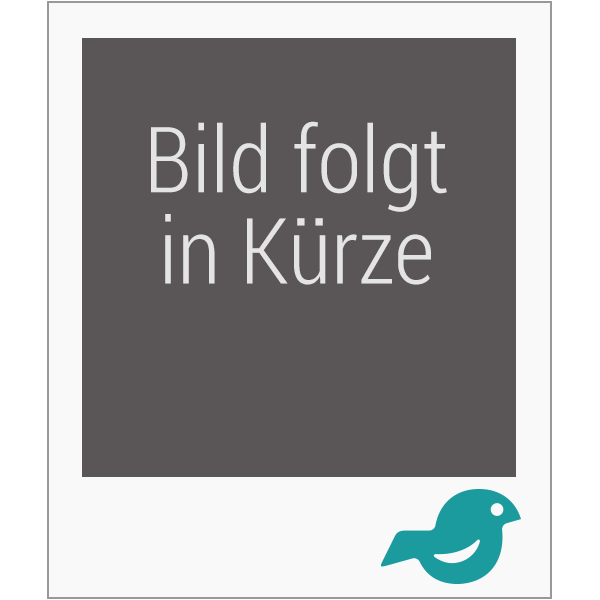In dem hier abgedruckten Fragment des Romans Le lieutenant-colonel de Maumort skizziert der Literatur- nobelpreisträger Roger Martin du Gard im Jahr 1943 drei Nationalsozialisten: Gralt, Kert und Weissmüller, die drei verschiedene Ausprägungen der nationalsozialistischen Ideologie repräsentieren. Der alte Maumort will sie begreifen – seinen unabhängigen Geist und seine kritische Distanz gibt er dabei nicht auf. Wer beim Lesen den Nazi in sich selbst erkennt, darf erschrecken. Wer, wie Maumort, manchmal sprachlos ist ebenfalls. Maumort und die Nazis, aus dem 22. Kapitel des Romans Le lieutenant-colonel de Maumort, von Roger Martin du Gard, wurde von Birthe Mühlhoff anhand der letzten Ausgabe aus dem Französischen übersetzt.

Der französische Schriftsteller Roger Martin du Gard ist ein in Deutschland vergessener Nobelpreisträger. Es ist Zeit, ihn zu entdecken: mit der beklemmenden Broschüre "Maumort und die Nazis".
Roger Martin du Gard bekam den Literaturnobelpreis 1937 zugesprochen, zum ungünstigsten Zeitpunkt für deutsche Leser. Zwei Jahre zuvor war zwar von keiner Geringeren als Eva Mertens, der künftigen deutschen Stimme von Marcel Proust und damaligen Assistentin von Ernst-Robert Curtius, dem wichtigsten literarischen Vermittler zwischen Frankreich und Deutschland, ein Roman des 1881 geborenen französischen Schriftstellers übersetzt worden: "Kleine Welt", im Original von 1933 "Vieille France". Die Rede vom alten Frankreich war von Martin du Gard keineswegs nostalgisch gemeint, sondern moralisch vernichtend: In seiner Schilderung eines einzigen Sommertages in einem Provinznest tun sich psychologische Abgründe auf. Über- und verkommen ist dieses Frankreich.
Das war im nationalsozialistischen Deutschland gut gelitten, doch 1936 fasste Hitler die Regierungsübernahme in Paris durch die Volksfront aus Sozialisten und Kommunisten als ideologische Kampfansage auf, und die Ehrung eines französischen Autors im Jahr danach wurde als politische Parteinahme des Nobelpreiskomitees gewertet, zumal Martin du Gard in der Begründung gepriesen wurde "für die künstlerische Kraft und Wahrheit, mit der er sowohl menschlichen Zwiespalt als auch grundlegende Aspekte des gegenwärtigen Lebens in seinem Romanzyklus ,Les Thibault' dargestellt hat". Die achtteilige Familiensaga hatte er 1922 begonnen, und 1937 war die Handlung im August 1914 angelangt, also beim Kriegsausbruch. Martin du Gard, seinerzeit selbst Soldat über die ganze Dauer des Kriegs hinweg, ließ als Erzähler keinen Zweifel an seiner pazifistischen Haltung. Seine deutschsprachige Publikationsgeschichte hatte sich damit im "Dritten Reich" erledigt.
Nachwirkende Ressentiments aus der NS-Zeit
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nicht viel besser. Erst in Martin du Gards Todesjahr 1958 erschien im Wiener Zsolnay-Verlag wieder eine neue Übersetzung, abermals von Eva Mertens und nun endlich die seines Hauptwerks "Die Thibaults", aber sie blieb in der Bundesrepublik ohne große Wirkung - die Ressentiments aus der NS-Zeit gegen den Autor wirkten noch nach; als Rowohlt 1960 eine Taschenbuchausgabe der "Thibaults" publizierte, wurden die dem Ersten Weltkrieg gewidmeten Teile des Zyklus weggelassen. In der DDR dagegen wurde er mehrfach komplett nachgedruckt. Trotzdem ist Roger Martin du Gard heute im deutschen Sprachraum einer der unbekanntesten Nobelpreisträger, keine der ohnehin wenigen alten Übersetzungen seines umfangreichen Werks ist lieferbar.
Nun aber gibt es eine neue, und man kann nicht umhin, sie als Großtat zu feiern, obwohl es sich um ein ganz kleines Buch handelt. Im Materialverlag, einer vor allem Lehr- und Forschungszwecken dienenden unkommerziellen Einrichtung der Hamburger Hochschule für bildende Künste (HFBK), ist vor wenigen Wochen in Winzauflage als preiswerte Broschüre "Maumort und die Nazis" erschienen: die deutsche Erstübersetzung eines Teils des Fragment gebliebenen Großromans "Le lieutenant-colonel de Maumort", an dem Martin du Gard in den letzten achtzehn Jahren seines Lebens gearbeitet hat. Der Vergleich mit dem 1983 von André Daspre in der französischen Klassikerreihe "Pléiade" edierten Romantorso könnte grotesk erscheinen: 84 winzige deutsche Seiten in großer Drucktype gegenüber mehr als tausend engbedruckten im doppelt so großen Format der 2008 nochmals revidierten Ausgabe des Verlags Gallimard. Aber in diesen 84 Seiten steckt für Deutschland eine Sensation.
Martin du Gard hatte seine "Thibaults" im Januar 1940 mit dem achten Teil, dem Roman "Epilog", abgeschlossen. Im Mai danach erfolgte der deutsche Einmarsch, der Frankreich in wenigen Wochen zur Kapitulation zwang. Unter dem Eindruck dieses Debakels und eigener Erlebnisse des von deutscher Kultur begeisterten Schriftstellers mit Besatzungssoldaten entstand die Idee, ein neues literarisches Großprojekt um die Figur eines Offiziers Maumort zu beginnen, der namentlich schon 1920 in den ersten Entwürfen zu den "Thibaults" aufgetaucht war, damals noch als moralisch dubiose Persönlichkeit, die eine der Hauptfiguren in den Kriegstod treiben sollte. Dieser Strang war im fertigen Romanzyklus nicht mehr enthalten, aber Martin du Gard war mit seiner Figur weiterhin beschäftigt. Angesichts des aktuellen Geschehens von 1940 wandelte sie sich: Maumort, geboren 1870, im Jahr der ersten katastrophalen Kriegsniederlage Frankreichs gegen Deutschland, ist mit siebzig selbst ein leidender Mann, gesundheitlich, aber auch weil seine beiden Söhne im Ersten Weltkrieg getötet wurden - der eine an der Front, der andere als Deserteur. Als die Deutschen 1940 seinen Landsitz beschlagnahmen und zur Kommandostelle mit Lazarett umwandeln, tauscht sich der pflegebedürftige Alte mit drei Wehrmachtssoldaten aus. Diese Gespräche sind der Inhalt von "Maumort und die Nazis".
Störungsanfälliger Schlaf des Vernünftigen
Martin du Gard hatte Deutschland 1938 zum letzten Mal bereist und war angewidert von den Veränderungen durch die NS-Herrschaft. Um sie zu verstehen, las er "Mein Kampf" und versuchte die Faszination für Hitler zu durchdringen. Sein neuer Roman gab ihm nun die Möglichkeit, die Ergebnisse dieser Beschäftigung zu fixieren, und weil er nicht zu einer eindeutigen Erklärung gekommen war, schuf er mit Maumorts Gesprächspartnern drei Typen von Nationalsozialisten: einen fanatischen Aufsteiger aus kleinen Verhältnissen, einen skrupellosen Revanchisten aus großbürgerlicher Familie und einen gebildeten Schöngeist aus dem deutschen Pfarrhaus. Letzterer, Rupert Gralt, ist der Gefährlichste des Trios.
Nicht, weil er im Roman Maumort oder sonst wem etwas antäte, sondern weil Gralts Argumentation in den Gesprächen etwas Verführerisches hat. Goethes Mephistopheles ist hier Sanitäter geworden, nicht einmal Parteimitglied wie die beiden anderen Soldaten, aber mit allen intellektuellen Wassern gewaschen, so dass er subtil über die Lebensuntüchtigkeit des wie Montaigne in seiner Bibliothek lebenden französischen Hausherrn spotten kann. Es ist keine Kunst, in Maumort ein Selbstporträt Martin du Gards zu identifizieren; Montaigne war einer seiner drei literarischen Hausgötter - neben Goethe und Tolstoi. Als "École de Tolstoi, et pas école de Proust" bezeichnete er seine eigenen Schwierigkeiten bei der Schilderung von Gefühlen; ihn interessierte das Geistige. Wie zum Hohn lässt Martin du Gard das Manuskript seines Maumort-Romans allerdings mit einer Variation des berühmten Auftaktsatzes ("Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen") zu Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" beginnen: "Mein Schlaf war schon immer leicht und störungsanfällig."
Entsprechend hellhörig ist dieser Maumort, und in Gralts Beschwörung einer völkerverbindenden "europäischen Föderation, die nur entstehen kann, wenn es einen mächtigen zentralen Staat gibt, der die Führungsposition einnimmt" (natürlich Deutschland), erkennt er das Paradox einer nationalsozialistischen Vorstellung von Freiheit, die aus dem Willen zur Unterordnung bestehen soll. Gralts Appelle an die Vernunft arbeiten mit der historischen Erkenntnis, dass nichts auf Dauer gestellt sei, also auch nicht Menschenrechte oder Liberalismus. Solche Argumentationen sind nicht auf das Jahr 1940 beschränkt.
Birte Mühlhoff, die Übersetzerin von "Maumort und die Nazis", und Wigger Bierma, Typographielehrer an der HFBK und Spiritus Rector des Materialverlags, schreiben in ihrer kurzen Einleitung: "Auf eine solche Weise konzipierte Romanfiguren sind wie eine glänzende, polierte Oberfläche, in der man in manchen Momenten, verzerrt, das eigene Spiegelbild erkennt." Es ist noch schlimmer: So viel Verzerrung ist da gar nicht. In der Krisenstimmung der Corona-Zeit mit ihrem Wandel der EU-Wahrnehmung als national bestimmte Egoistische Union statt kulturübergreifender Europäischer Union hat Martin du Gards "Maumort" uns mehr zu sagen als jede andere Literatur. Bienvenu à l'Allemagne.
ANDREAS PLATTHAUS
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main