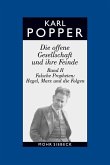Immer wieder hat sich Max Weber kritisch mit dem preußischen Landadel, den ominösen 'Junkern', auseinandergesetzt. Dabei sah er die Junker als Repräsentanten des wilhelminischen Gesellschaftssystems, bildeten ihre Rolle und Stellung für ihn den 'Schlüssel' zur Erschließung der gesellschaftlichen Struktur des Deutschen Kaiserreichs und ihrer spezifischen Probleme. Zum ersten Mal wird Webers Sicht des Junkertums eingehend analysiert. Cornelius Torp zeigt, daß sich Webers Position nur vor dem Hintergrund der tiefgreifenden kapitalistischen Umwälzung in den ostelbischen Agrarverhältnissen begreifen läßt. Die Klassengesellschaft hielt unwiderruflich Einzug auch auf den Rittergütern der Junker. Für den sozialen Charakter des preußischen Landadels bedeutete das einen dramatischen Wandel. Einstmals ein staatstragender und leistungsfähiger 'Herrschaftsstand', entwickelte sich das Junkertum - so Max Weber - immer mehr zu einer sich im 'ökonomischen Todeskampf' windenden 'landwirtschaftlichen Unternehmerklasse', die freilich weiterhin ihre traditional dominante Stellung in Staat und Gesellschaft unnachgiebig beanspruchte. Die weitgehend erfolgreiche Verteidigung dieses Anspruches in einem rücksichtslosen Defensivkampf führte nach Webers Ansicht zu einer verhängnisvollen Blockade von Entwicklungen, die gewissermaßen auf der historischen Tagesordnung der deutschen Gesellschaft auf ihrem Weg in die Moderne standen. Cornelius Torp arbeitet heraus, welche leitenden politischen Werte es waren, die Max Weber zu seiner - häufig mit ätzender Schärfe vorgetragenen - Kritik an den preußischen Junkern veranlaßten.

Der leidenschaftliche Imperialist: Max Weber und die preußischen Junker
Cornelius Torp: Max Weber und die preußischen Junker. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1998. 149 Seiten, 39,- Mark.
Im Winter 1891/92 veranstaltete der Verein für Sozialpolitik eine Umfrage zur Lage der Landarbeiter in Deutschland. Die Auswertung der Berichte über die an Großgrundbesitz reichen Provinzen Ostelbiens übernahm Max Weber, damals knapp 28 Jahre alt und Privatdozent der Rechte in Berlin. Innerhalb weniger Monate schrieb er eine rund tausend Seiten umfassende Studie und qualifizierte sich damit als Agrarfachmann; seiner Berufung auf den Freiburger Lehrstuhl für Nationalökonomie war das sehr förderlich. Im Interesse der Objektivität, so sagte er wenige Wochen nach dem Abschluss der Schrift in einem Privatbrief, habe er gemeint, "die uns Liberalen naturgemäß innewohnende Abneigung gegen die östlichen Großbesitzer unterdrücken zu müssen". Aber er fand bei der Auswertung der Enquête doch deutliche Worte: dass der ostelbische Großgrundbesitz, der immer noch zu einem beachtlichen Teil in der Hand des Adels war, zwangsläufig im Übergang von patriarchalischen zu kapitalistischen Strukturen begriffen sei, dass also die ganzjährige Beschäftigung der Insten (dem Gut eng verbundene Menschen) durch freie Lohnarbeit je nach Bedarf ersetzt werde, vor allem durch Rückgriff auf Saisonarbeiter aus Galizien und Russisch-Polen. Er gab zu, dass zahlreiche Großbetriebe nur so die seit den siebziger Jahren scharfe Konkurrenz mit ausländischen Getreideanbietern bestehen konnten, ließ aber keinen Zweifel daran, dass er diese Entwicklung als wirtschaftlich und nationalpolitisch verfehlt ansah.
Vom zunehmenden Einsatz polnischer Arbeitskräfte befürchtete er eine Schwächung des Deutschtums im Osten. So musste der Staat sich seines Erachtens zum Eingreifen entschließen, um die Dinge in eine den Interessen der Nation entsprechende Bahn zu lenken. Der Import fremder Arbeitskräfte müsse aufhören, ein groß angelegtes Siedlungswerk begonnen werden. Diejenigen Betriebe seien am existenzfähigsten, die mit möglichst wenig fremden Kräften arbeiteten, einen erheblichen Teil ihrer Produkte selbst verzehrten und mit dem Überschuss die lokalen Märkte aufsuchten.
Vaterlandsloses Landproletariat.
Weber sprach sich also für eine nachhaltige Stärkung des kleineren bäuerlichen Besitzes aus. Seine Wünsche für den deutschen Osten fasste er so zusammen: "Die Dynastie der Könige von Preußen ist nicht berufen zu herrschen über ein vaterlandsloses Landproletariat und über slawisches Wandervolk neben polnischen Parzellenbauern und entvölkerten Latifundien, wie sie die jetzige Entwicklung . . . bei weiterem Gehenlassen zu zeitigen vermag, sondern über deutsche Bauern neben einem Großgrundbesitzerstand, dessen Arbeiter das Bewußtsein in sich tragen, in der Heimat ihre Zukunft im Aufsteigen zu selbständiger Existenz finden zu können."
Mit der Landarbeiterfrage beschäftigte sich Weber noch einige Zeit. Auf die Junker kam er im nächsten Vierteljahrhundert, bis 1918, immer wieder in den verschiedensten Zusammenhängen zurück. So ist es erstaunlich, dass das Thema in der umfangreichen Weber-Literatur bisher zwar wiederholt berührt, aber erst jetzt auch monographisch abgehandelt wurde. Cornelius Torp führt alle wesentlichen Äußerungen Webers zu den preußischen Junkern an und ordnet sie in den Zusammenhang seines Denkens ein. Dabei wird deutlich, dass Webers Sicht im Laufe der Zeit zwar gewisse Verschiebungen bei der Gewichtung einzelner Aspekte, aber keine grundsätzliche Änderung erfuhr. Im Ton aber wurde er schärfer, schon im März 1893, als er vor dem Verein für Sozialpolitik über die Landarbeiterfrage referierte, ebenso bei seiner Freiburger Antrittsvorlesung im Mai 1895 und auch bei späteren Gelegenheiten.
Weber vertrat immer wieder die Ansicht, dass das Junkertum in einem chronischen Verfallsprozess begriffen sei und damit für den Staat wertlos werde. Aus dem einstigen staatstragenden und leistungsfähigen Herrschaftsstand, der mit Recht Ansprüche stellen konnte, war seines Erachtens eine sich im ökonomischen Todeskampf windende Unternehmerklasse geworden, die freilich lebhaft um den Erhalt ihrer bisherigen Stellung kämpfte und deshalb nicht bereit war, ihre bisherigen Privilegien aufzugeben, die Bevorzugung im Offizierskorps, im auswärtigen Dienst und in der Bürokratie, die verbliebenen gutsherrlichen Rechte, die Sonderstellung im legislativen Prozess über das weitgehend dem Adel vorbehaltene Herrenhaus und das preußische Dreiklassenwahlrecht, das sich zunehmend als Bastion des Konservativismus erwies. Weber hielt die Beamtenschaft keineswegs für überparteilich, wie sie zu sein vorgab, sondern bezeichnete das bürokratische Regime als krasseste agrarisch-konservative Parteiherrschaft.
Da er das Reich als Großpreußen sah, hatten die Ostelbier nach seiner Auffassung auch im Reich sehr günstige Durchsetzungschancen. Immer wieder beklagte er, dass die "allmächtige agrarische Phrase" die deutsche Wirtschaftspolitik beherrsche. Dadurch werde Deutschland bei der Ausbildung seiner Industriestaatlichkeit behindert, und daraus wiederum entstehe dem Reich ein nicht wieder gutzumachender Schaden. Da das Junkertum auf der Heranziehung polnischer Wanderarbeiter beharre, sei es zudem der größte Polonisator und mithin der gefährlichste Feind der deutschen Nationalität.
Weber argumentierte in diesem Zusammenhang ausgesprochen rassistisch. Er sprach von der tiefer stehenden polnischen Rasse und meinte gelegentlich, dass die Deutschen die Polen eigentlich erst zu Menschen gemacht hätten. In seine Adelskritik bezog er zunehmend das Bürgertum mit ein. Seines Erachtens wuchs dort die Tendenz zur Feudalisierung. Diese Bereitschaft zur Anpassung bezeichnete er als Verrat an der eigenen Klasse. Das großbürgerlich-junkerliche Machtkartell, das er sich entwickeln sah, betrachtete er mit großer Skepsis. Er fürchtete, dass daraus ökonomische Stagnation erwachse.
Weber wünschte, dass das Bürgertum den Adel aus seiner führenden Stellung verdränge. Tief beklagte er, dass es dazu kaum Ansätze gab. In seiner Freiburger Antrittsvorlesung bezeichnete er es als gefährlich, dass eine ökonomisch sinkende Klasse die Macht in Händen hielt, als noch gefährlicher erschien ihm der Zustand, dass die Klassen, zu denen sich die wirtschaftliche Macht bewegte, noch nicht reif zur Lenkung des Staates waren. Den fehlenden Reifegrad erschloss er auch aus dem "Friedensdurst" und der eigenartig unhistorischen und unpolitischen Denkweise, die seines Erachtens die Deutschen nach der Reichseinigung befallen hatten. Er fürchtete, dass die bürgerlichen Klassen die Machtinteressen der Nation, die er hoch über alle anderen Interessen stellte, verkümmern ließen. "Nicht Frieden und Menschenglück haben wir unseren Nachfahren mit auf den Weg zu geben", sagte er an einer von Torp nicht zitierten, ganz sozialdarwinistisch getönten Stelle, "sondern den ewigen Kampf um die Erhaltung und Emporzüchtung unserer nationalen Art." Mit der höchstmöglichen Entfaltung wirtschaftlicher Kultur sei es nicht getan, die Auslese im freien und friedlichen Völkerkampf komme nicht von selbst zum Ziel. Es gehe um die Erkämpfung von Ellenbogenraum in der Welt. Weber entpuppt sich hier als leidenschaftlicher Imperialist.
Nur Herrenvölker.
Es gab vor hundert Jahren nicht viele Äußerungen dieser Art. Torp sucht ihren harten Klang zu dämpfen, indem er meint, Webers Imperialismus habe wesentlich eine innenpolitische Funktion gehabt, er sei ihm als geeignetes Mittel für die Aufsprengung der verkrusteten inneren Strukturen in Deutschland erschienen. Hier geht die Interpretation in die Irre. Webers Imperialismus war nicht zweckgebunden. Nationale Kraft und Größe hatten für ihn einen eigenen Wert, einen sehr hohen Rang, mögen sie auch nicht, wie Ernst Troeltsch vor Jahrzehnten meinte, der einzige "Wertgott" Webers gewesen sein. Imperialismus und Demokratie standen für Weber allerdings in einem sehr engen Zusammenhang. "Nur Herrenvölker haben den Beruf, in die Speichen der Weltentwicklung einzugreifen", schrieb er 1917.
Die Deutschen hielt er nicht für ein Herrenvolk, da sie zwar gute Beamte, schätzbare Bürokräfte, ehrliche Kaufleute, tüchtige Gelehrte und Techniker sowie treue Diener hervorbrächten, im Übrigen aber "eine kontrollfreie Beamtenschaft unter pseudomonarchischen Phrasen über sich ergehen" ließen. Ein Herrenvolk müsse sich selbst regieren. Über Webers Aussage, für ihn sei Demokratie niemals Selbstzweck, ihn interessiere allein die Möglichkeit "einer sachlichen nationalen Politik eines starken nach außen geeinigten Deutschland", geht Torp mit dem fragwürdigen Argument hinweg, dies sei wenigstens teilweise Legitimationsrhetorik gewesen. Völlig richtig aber ist sein Hinweis, dass Weber die Demokratie - freilich unter einem cäsaristischen Diktator - als entscheidende Waffe im Kampf gegen die von ihm prognostizierte Gefahr der Erstarrung der Gesellschaft in bürokratischer Routine und bei der Abwehr der neuen Hörigkeit betrachtete, die er drohend heraufziehen sah.
Die schmale Schrift Torps ist stets anregend, die Analyse durchweg überzeugend. So bringt die Lektüre viel Gewinn. Allerdings hätte der Autor gut daran getan, noch ein weiteres Kapitel anzufügen. Er durfte sich nicht mit dem Nachweis begnügen, dass es die webersche Sicht des Junkertums im Sinne einer argumentativen Einheit tatsächlich gibt, er hätte auch untersuchen müssen, ob diese Sicht und die mit ihr verbundene Charakterisierung des Kaiserreichs die Strukturen in Deutschland zwischen 1890 und 1918 angemessen widerspiegelt oder nicht. Nur in den Anmerkungen äußerst sich Torp gelegentlich in diesem Sinne - viel zu selten. Immerhin sind hinsichtlich der Genauigkeit von Webers Sehweise erhebliche Zweifel anzumelden. Vielleicht hat Torp diese weiterführende Frage nicht gestellt, weil das heute in der Geschichtswissenschaft weithin akzeptierte Urteil über Rolle und Stellung des Junkertums maßgeblich von Weber beeinflusst ist.
HANS FENSKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main