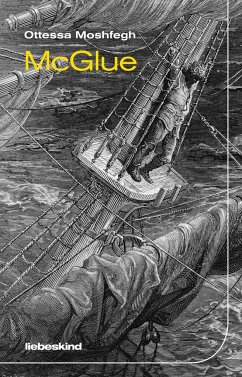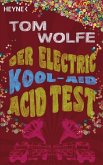Salem, Massachusetts. Im Jahr des Herrn 1851. Der Seemann McGlue ist schwerer Trinker und sitzt im Gefängnis. Ihm wird vorgeworfen, vor Sansibar seinen besten Freund Johnson ermordet zu haben. Nur kann er sich an nichts erinnern. Was daran liegt, dass sein Schädel gespalten ist, seitdem er vor Monaten aus einem fahrenden Zug gesprungen ist, um nicht als blinder Passagier entdeckt zu werden. McGlue will sich auch an nichts erinnern, er will nur trinken. In der Nähe von New Haven hatte Johnson ihn einst auf der Straße aufgelesen und so vor dem Erfrieren gerettet. Er war es, der nach seinem Sturz für ihn sorgte, der ihn zur Handelsmarine brachte und mit ihm um die Welt segelte. Warum also sollte McGlue ihn umgebracht haben?
Ottessa Moshfegh erzählt die abgründige Geschichte eines Mannes, dessen Hass auf die Welt zu groß ist, als dass er unversehrt sein Dasein fristen kann. "McGlue" ist ein stimmgewaltiges, eindringliches Buch über das immerwährende Scheitern des Menschen, den eigenen Unzulänglichkeiten Herr zu werden. Denn zwischen Schuld und Gerechtigkeit steht immer das Leben.
Ottessa Moshfegh erzählt die abgründige Geschichte eines Mannes, dessen Hass auf die Welt zu groß ist, als dass er unversehrt sein Dasein fristen kann. "McGlue" ist ein stimmgewaltiges, eindringliches Buch über das immerwährende Scheitern des Menschen, den eigenen Unzulänglichkeiten Herr zu werden. Denn zwischen Schuld und Gerechtigkeit steht immer das Leben.

Ein Ausblick auf die schönsten Romane des Herbstes / Von Andreas Platthaus
Weltliteratur, das ist ein großes Wort, und es bedurfte eines selbstbewussten Geistes, den Begriff zu prägen. Die Einordnung neuer Bücher in diese Kategorie grenzt an Hybris: Wie sollen sie den Vergleich mit dem, was Goethe darunter fasste - Bücher, die zur ganzen Welt sprechen und ihr vor allem auch etwas zu sagen haben -, aushalten? Notwendig erst mit der Zeit erweist sich, was von einem Buch bleibt und ob es Verbreitung über die eigene Sprachgrenze hinaus findet.
Aber wie steht es um Weltliteratur in einem bescheideneren Verständnis, um Literatur, die uns die Welt erschließt? Die thematisch nicht in nationalen oder kulturellen Grenzen verbleibt, sondern den Blick weiter richtet, auf den Austausch zwischen Ländern und Gesellschaften, inklusive der Missverständnisse, die daraus entstehen. Oder bei der es sich um Literatur handelt, die auch innere Grenzen überschreitet, an denen unsere Erfahrung üblicherweise haltmacht, weil jenseits davon ein derart unbekanntes Gebiet liegt, dass wir den Eintritt lieber nicht wagen wollen.
Aber haben wir eine Wahl? Die Begrüßungs- oder besser: Verfluchungsfloskel über dem Eingang zur Hölle, wie Dante sie vor siebenhundert Jahren in der "Commedia" erfunden hat - "Ihr, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren" -, ist ja gerade kein Eintrittsverbot gewesen, sondern eine Art Hausordnung. Eine Wahl stellte sich gemäß Dantes Weltverständnis für die nach dem Tod Verdammten nicht. Da haben wir es als Lebende angesichts der Weltverhältnisse besser. Aber ganz entziehen können wir uns ihren Zumutungen nicht. Und Literatur hält glücklicherweise die Mittel parat, uns Erfahrungen ohne unmittelbares Erleben zu verschaffen.
Sie kann aber auch Menschen Erfahrungen andichten, die sie gar nicht machen mussten. Der englische Uhrmacher James Cox etwa ist nie nach China gereist, obwohl er eine Uhr anfertigte, die von der Ostindischen Kompanie 1766 dem Qianlong-Kaiser zum Geschenk gemacht wurde. Christoph Ransmayr lässt Cox (der bei ihm mit Vornamen Alister heißt) nun doch nach China fahren, sogar schon im Jahr 1753, weil derselbe Kaiser ein nie dagewesenes mechanisches Wunderwerk von dem berühmten Meister aus Europa gebaut bekommen soll: eine zeitlose Uhr - zeitlos insofern, als sie über alle Zeiten Bestand haben und funktionsfähig bleiben soll. Was der Engländer auf seiner Reise sieht, bewundert und bedauert, ist Gegenstand von Ransmayrs neuem Roman "Cox oder Der Lauf der Zeit" (S. Fischer, Erscheinungstermin am 27. Oktober).
Das Einfühlungsvermögen des Autors in Menschen einer vergangenen Epoche und Sprachmacht wie -eleganz von "Cox" lassen den Vergleich mit "Die letzte Welt" zu, Ransmayrs 1988 erschienenem Erfolgsbuch, in dem er den römischen Dichter Ovid an dessen Verbannungsort am Schwarzen Meer nicht zum Gegenstand eines historischen Romans, sondern einer verkappten Gegenwartsstudie gemacht hatte, weil in dieser Figur das ganze Drama des Intellektuellen zum Ausdruck kam. Cox nun ist wieder so eine Figur, nur dass diesmal kein Denker, sondern ein Macher in Konfrontation mit dem Fremden porträtiert wird: ein Mecanicus in dem Sinne, dass sich in ihm Mensch und Uhrwerk zu verbinden scheinen, während der Kaiser ein Dichter auf dem Thron ist. Das Unvergleichliche, hier ist es gleich zweimal getan: einmal historisch belegt, das andere Mal brillant erfunden.
Ransmayr betont allerdings in einer als Postskript beigegebenen Erläuterung: "Die Gestalten dieses Romans sind keine Gestalten unserer Tage." Das stimmt, weil große Literatur denselben Anspruch hat wie das Uhrwerk von Cox: zeitlos zu sein. Doch es verhält sich mit der zeitlosen Weltliteratur genauso wie mit der zeitlosen Uhr - dass sie zu jeder Zeit Gültigkeit besitzt, macht ihre Zeitlosigkeit aus, nicht der Verzicht auf Zeitbezug. Cox erfährt es selbst: "Er empfand, dass dieser eine Augenblick im Angesicht des Kaisers und seiner Geliebten keiner Zeit mehr angehörte, sondern ohne Anfang und Ende war, um vieles kürzer als das Aufleuchten eines Meteoriten und doch von der Überfülle der Ewigkeit: von keiner Uhr zu messen . . ." Der Roman "Cox" verschiebt die Grenzen des Literarischen, indem er Grenzen fallen lässt, die uns bislang vom achtzehnten Jahrhundert trennten.
In kleinerem Maßstab, weil in der Gegenwart angesiedelt, ist auch "Hool" so ein Grenz- und Grenzenfall, der Debütroman von Philipp Winkler (Aufbau Verlag, 19. September). Die im Präsens gehaltene Prosa des dreißigjährigen in Leipzig lebenden Schriftstellers bietet jene Unmittelbarkeit, die das Buch uns realiter erspart. Sein Ich-Erzähler Heiko ist in den Zwanzigern und Teil der Hannoveraner Hooligan-Szene. Nach festen Verabredungen trifft man sich mit gleichgesinnten, vulgo gewaltfreudigen Anhängern anderer Fußballclubs abseits des Stadions vor einem Spiel oder besser noch währenddessen (weil die Polizei dann abgelenkt ist), um zu "matchen". Die Zahl der Teilnehmer ist bei diesen Schlachten ebenso festgelegt wie die erlaubten Hilfsmittel. Doch außerhalb der ritualisierten Prügeleien toben interne wie externe Konkurrenzkämpfe, bei denen keine Regeln beachtet werden.
"Hool" ist aber noch mehr als ein gespenstisch intensiver Einblick in eine sonst hermetisch verschlossene Welt, es ist auch das Soziogramm eines jungen Erwachsenen, der nichts hat außer der Gewalt. Seine Mitstreiter springen nach und nach ab, begründen Familien und Karrieren, während sich Heiko immer tiefer in die Abgründe der Szene begibt, weil er von einem Ideal nicht lassen will, das ihn als Letztes noch mit einer Zeit verbindet, die unschuldig genannt werden konnte und doch den Keim zur Schuld schon legte. Hier rutscht Heiko erzählend ins Präteritum: "Ich weiß noch genau, wie mich mein Vater ins Schlafzimmer rief. Wie er seine geliebte Weste vom Kleiderhaken nahm, sich überstreifte und ganz glücklich und zufrieden dreinschaute. Dann bückte er sich runter zu mir, hielt mich fest und tippte mit dem Finger gegen einen der vielen Aufnäher. Auf die fette schwarze 96. Und er sagte: ,Das is' noch was, du. 96. Ja, Heiko. Das is' noch was.'" Am Schluss also wieder Gegenwart: Dass Heikos Welt ein Teil der unseren ist, dass es nur einer oder zweier Schritte über bestimmte Schwellen bedarf, um ein Terrain zu betreten, auf dem andere Regeln und Werte gelten, darum geht es in diesem kompromisslosen Roman.
Von ähnlicher Gewalt, die aber psychischer statt physischer Natur ist, obwohl auch dabei Mord und Totschlag den Ausgangspunkt des Geschehens bieten, ist "McGlue" von der jungen Amerikanerin Ottessa Moshfegh (Verlagsbuchhandlung Liebeskind, 22. August). Das Buch versetzt uns in den schwer angeschlagenen Kopf des Titelhelden, eines Matrosen, der im Jahr 1851 in Salem, Massachusetts, dem Schauerort der amerikanischen Literatur schlechthin, auf Selbsterkundung ausgeht: ins Innere, das sich als weitaus dubioser erweist als die Außenwelt. Auch Moshfegh erzählt ihren historischen Stoff, der auf eine Zeitungsnotiz zurückgeht, meist im Präsens - mit einer Ausnahme, die exakt Philipp Winklers Verfahren entspricht -, denn von den bösen Aspekten seiner Vergangenheit weiß McGlue nicht mehr, als was man ihm erzählt. Der Rest sind Visionen und moralische Indifferenz: "Ich stehe. Ich stehe und bete, nur um zu sehen, was passiert. Ich lege die Hand aufs Herz, anders beten kann ich nicht. Ich bin mir sicher, dass nichts wirklich Böses in meinem Herzen ist. Es ist einfach nur leer."
Nicht, dass McGlue dort etwas vermisste. Was dieses Buch beschreibt, ist eine im Wortsinn gespaltene Persönlichkeit, eine höchst moderne Figur in historischer Kulisse und dadurch gerade noch erträglich. Moshfegh nutzt unsere literarischen Referenzen (und die Übersetzerin Anke Caroline Burger trifft den resultierenden Zwischenton exakt), um aus Melville, Poe und Lovecraft eine Achterbahnfahrt durchs Unterbewusste zu formen, die nur am Schluss dadurch irritiert, dass sie tatsächlich an ein Ziel führt. Was McGlue dort findet, ist aber wiederum von einer Zweideutigkeit, die dazu taugt, diese Figur als ein Insignium der Moderne zu etablieren.
Humor haben weder Ransmayr noch Mosfegh, noch Winkler im Programm, weil es ihnen bitterernst mit ihren Protagonisten ist. Dass beides miteinander vereinbar ist, zeigt Sibylle Lewitscharoff mit "Das Pfingstwunder" (Suhrkamp, 10. September), einem Roman, der dort wiederanknüpft, wo die Autorin vor sieben Jahren literarisch auf die schiefe Bahn geriet: bei dem grandiosen pseudoautobiographischen Roman "Apostoloff", dem dann der völlig überschätzte "Blumenberg", die berüchtigte Dresdner Rede zur Reproduktionsmedizin und die platte Krimifarce "Killmousky" folgten. Doch "Das Pfingstwunder" ist wie die nachträgliche Rechtfertigung des zwischenzeitlich an sie verliehenen Büchnerpreises: eine wortgewaltige und witzige Dante-Exegese im Gewand eines Romans, der seinen Protagonisten, einen Frankfurter Romanisten, auf das übersinnliche Ende eines Fachkongresses in Rom zurückblicken lässt. Da liest, lernt und lacht man. "Nichts als eine tumbe Nacherzählung habe ich betrieben, als müsste ich sechzehnjährigen Gymnasiasten beibringen, wovon in der Commedia die Rede ist. Riese eins, Riese zwei, Riese drei, Riese vier - hebt eure Fingerchen, Kinder, und zählt mit! Dann schwatz' ich euch womöglich noch von Sankt Peters Pinienzapfen die Hucke voll, der heute in den Gärten der Vatikanischen Museen zu besichtigen ist. Kinder, schaut's lieber mal selber nach, was es mit dem Zapfen auf sich hat." Dieser Roman erfreut schimpfend.
Dass Lewitscharoff selbst auch bei einem männlichen Ich-Erzähler immer mit drinsteckt, weil sie einfach nicht aus ihrer Haut kann, hat hier die schönsten Folgen, weil die regelmäßigen Erregungen das Dantesche Schwanken zwischen den Sphären evozieren. Sibylle Lewitscharoff nimmt nur die "Commedia" bitterernst (in religiösem Sinne, aber vor allem als literarischen Maßstab), während sie aus ihren Figuren freudig Klischeegestalten machen kann, weil die Hauptrolle in diesem Roman eh Dantes Buch spielt.
Die Handlungszeit des "Pfingstwunders" deckt einen Zeitraum von nur wenigen Wochen im Frühjahr 2013 ab und erzählt doch von viel mehr, von einer ganzen Kultur. Gleiches gilt für Bodo Kirchhoffs meisterhaft komponierte Novelle "Widerfahrnis" (Frankfurter Verlagsanstalt, 1. September). Hier sind es nur vier Tage im April 2015, an denen ein im bayrischen Ruhestand lebender Kleinverleger eine Autorin ungefähr gleichen Alters kennenlernt, mit der zusammen er spontan im Auto nach Italien aufbricht. Sie kommen bis Catania auf Sizilien, auf der Hinfahrt geht es vorbei an Flüchtlingscamps am Brennerpass, und bei der Rückfahrt auf der Fähre sitzt sogar eine Flüchtlingsfamilie mit im Auto, und der ältere Mann, der sich einen neuen Frühling erträumt hat, stellt fest, dass sich das Leben nicht so einfach ändern lässt, "aber diesen jungen Mann auf der Flucht, den beneidete er um sein Leben ohne Dach und ohne Bett, ohne Konto und ohne Fürsprache, mit nichts in der Hand außer Frau und Tochter und dem eigenen Mut". Da hat er die neue Bekanntschaft und die Hoffnung auf eine altersfrische Liebe bereits wieder eingebüßt.
"Widerfahrnis" hätte zum Titel eines im Buch erwähnten Werks der Schriftstellerin werden können, und in Kirchhoffs stattlicher Novelle von 220 Seiten, die man sich gerne noch länger gewünscht hätte, werden die Bedingungen für gelungenes Schreiben immer wieder thematisiert: Das Buch, das wir lesen, entsteht beim Erzählen. Das klingt banal, doch ist alles andere als selbstverständlich. Welcher Text legt schon sich selbst gegenüber Rechenschaft ab? Es ist ein poetologisches Kunststück, das Kirchhoff hier vollführt, und darüber hinaus ein Coming-of-Age-Stoff, der nicht als Einführung ins Erwachsenwerden, sondern ins Altwerden verstanden werden will. Wobei Kirchhoffs Verleger dadurch erst erwachsen wird.
Dante-Kongress in Rom, Selbstfindung und -verlust in Catania - es ist der italienische Herbst der Belletristik. Nicht nur thematisch, sondern auch nach langer Zeit wohl wieder einmal kommerziell. Seit Umberto Eco hat die italienische Literatur keinen Bestsellerautor auf dem deutschen Markt mehr hervorgebracht, doch nun deutet alles darauf hin, dass Elena Ferrantes Tetralogie "Meine geniale Freundin" (Suhrkamp, 6. September) auch hierzulande zu dem Erfolg wird, der sie schon in vielen Sprachen ist, in den englischsprachigen Ländern sogar noch mehr als in Italien selbst, aber auch auf Französisch und Spanisch. Warum es fünf Jahre gedauert hat, bis der erste, gerade einmal vierhundertseitige Teil ins Deutsche übersetzt wurde (die anderen drei deutlich umfangreicheren Bücher sollen nun in raschem Abstand folgen), ist unbegreiflich, aber besser spät als nie.
Meine geniale Freundin" erzählt die Geschichte zweier Frauen in Neapel von den fünfziger Jahren, als beide sich in der Schule kennenlernen, bis in die Gegenwart; der Prolog spielt 2010. Im nun erscheinenden ersten Teil, "Kindheit, frühe Jugend" untertitelt, wird eine nostalgische Welt entfaltet, in der alles von familiären Zuordnungen abhängt: Freund- und Feindschaften, Geschäfte, Eheschließungen, Karrieren. Elena Ferrante gelingt es, ein literarisches Gegenstück zum Neorealismus des italienischen Nachkriegskinos zu schaffen, mitsamt dessen charakteristischem Starsystem, denn ganz in der Tradition großer historischer Romane werden wir durch die wechselnden Konstellationen der Protagonisten gefesselt. Die Vergleiche mit Proust oder Tolstoi sind schon gezogen.
Sie sind Unsinn, denn Ferrantes Bücher halten diesen Jahrhundertwerken, Weltliteratur im Goetheschen Sinne, stilistisch nicht stand. Aber sie bieten ein Erzähltemperament, das selbst angesichts der eigentlich unmöglichen Herausforderung, den fürs Figurenverständnis zentralen Unterschied zwischen Dialogen auf Italienisch und neapolitanischem Dialekt ins Deutsche zu retten, in der Übersetzung seine Wirkung entfaltet. Karin Krieger hat aus der englischen Übersetzung die Hilfskonstruktion übernommen, bei neapolitanischen Dialogen ein "sagte sie im Dialekt" vorzuschalten, statt eine mundartliche Entsprechung im Deutschen zu suchen. Der Königsweg ist das nicht, aber es unterbricht auch den Sog dieser Prosa nicht.
Wer Elena Ferrante ist, weiß man nicht; es handelt sich um ein Pseudonym, und die meisten Interpreten vermuten dahinter ein männliches Autorengespann. Wäre dem so, müsste man ihm eine Meisterleistung psychologischer Einfühlung bescheinigen, denn die Erzählperspektive bleibt ganz die von Elena Greco, die hemmungslos die gleich alte Lila bewundert, während diese sie explizit als "meine geniale Freundin" bezeichnet. Diese wechselseitige Zusprechung von Genialität ist ein erzählerischer Kniff, der seine schönste Pointe leider im Deutschen dadurch verliert, dass der im Original unbestimmtere Buchtitel "L'amica geniale" zu "Meine geniale Freundin" und damit angesichts der Erzählhaltung eindeutig auf Lila bezogen wird. Der Clou des Stoffs liegt aber in der Kombination der jeweiligen Stärken beider Mädchen: "ich, ich mit Lila, wir beide mit der Fähigkeit, die wir zusammen - und nur zusammen - hatten, die Fähigkeit, die Masse der Farben, der Geräusche, der Dinge und der Menschen aufzunehmen, sie uns zu erzählen und ihr Kraft zu verleihen". Das ist die Selbstbeschreibung des Ferranteschen Projekts.
Nach allem noch einmal "Cox". Dass wir gerade auf diesen Roman noch so lange warten müssen, liegt an Ransmayrs Wunsch, dem Wettkampf um den Deutschen Buchpreis zu entgehen. Der Jury hat er damit einen Fettnapf aus dem Weg geräumt, denn wie hätte sie an diesem Buch vorbeigekonnt? In einem vergleichbar klaren Fall, Nino Haratischwilis "Das achte Leben (für Brilka)", hatte die damalige Jury vor zwei Jahren versagt. Ransmayr bietet einen Blick durch Raum und Zeit auf eine in jeder Hinsicht ferne Welt und macht sie uns mit dem staunenden Blick seines Mecanicus verständlich. Und wie als Spiegelbild des nur scheinbar Exotischen sehen wir uns selbst, in unserem Raum, in unserer Zeit. Was für eine Kunst! Weltliteratur, im bescheidenen wie im anmaßenden Verständnis des Begriffs.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Nicolas Freund findet den Hype um Ottessa Moshfegh berechtigt. Jedenfalls, wenn er ihr Debüt als Maßstab nimmt. Dass der Text, eigentlich ein Roman, nun aus preistaktischen Gründen als Novelle erscheint, ficht ihn nicht an. Die Story um einen Seemann, dem die Erinnerungen durcheinandergeraten, der keinen Ort findet und der möglicherweise ein Mörder ist, aber mit einem Herzen, erinnert ihn an Musil und Faulkner. Auch das Thema Staat und Individuum klingt für Freund in dieser Charakterstudie an. Die bewusst karge Sprache, meint er, wird in der Übersetzung leider mit angestaubten Begriffen verunstaltet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH