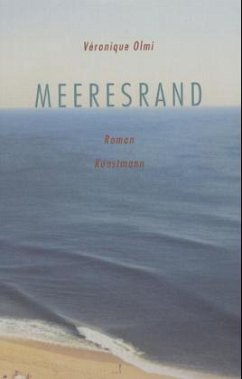Einmal sollen ihre beiden Söhne das Meer sehen. Das hat sie sich fest vorgenommen. Es ist ihre erste Reise und die letzte. Eine Reise ins Herz der Verzweiflung.
Eine Mutter bricht mit ihren beiden Söhnen zu einer Reise auf. Sie freuen sich, aber es ist ihnen auch unheimlich. Sie waren noch nie weg, und Ferien sind auch nicht. Aber die Mutter ist fest entschlossen: Ihre Kinder sollen das Meer sehen, wenigstens einmal. Da spielt es keine Rolle, wie verlassen und trostlos der kleine Küstenort ist und dass sie von ihrem Hotelzimmer auf eine Betonwand schauen, nicht auf den Strand. Diese Reise hat sie geplant, auch wenn sie sonst nie planen kann. Sie werden ans Meer gehen und abends auf die Kirmes. Die Kinder sollen es gut haben. Bis sie kein Geld mehr hat und auch der Mut sie verlässt. Denn es ist eine Reise ohne Wiederkehr, eine Reise in das Herz der Verzweiflung.
Eine Mutter bricht mit ihren beiden Söhnen zu einer Reise auf. Sie freuen sich, aber es ist ihnen auch unheimlich. Sie waren noch nie weg, und Ferien sind auch nicht. Aber die Mutter ist fest entschlossen: Ihre Kinder sollen das Meer sehen, wenigstens einmal. Da spielt es keine Rolle, wie verlassen und trostlos der kleine Küstenort ist und dass sie von ihrem Hotelzimmer auf eine Betonwand schauen, nicht auf den Strand. Diese Reise hat sie geplant, auch wenn sie sonst nie planen kann. Sie werden ans Meer gehen und abends auf die Kirmes. Die Kinder sollen es gut haben. Bis sie kein Geld mehr hat und auch der Mut sie verlässt. Denn es ist eine Reise ohne Wiederkehr, eine Reise in das Herz der Verzweiflung.
Eine Reise ohne Wiederkehr
Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Frau und ihren beiden Jungen, die mitten in der Nacht aufbrechen, um an ein kleinen Ferienort am Meer zu fahren. Dieses Unbehagen, das den Leser bereits auf den ersten Seiten erfasst, steigert sich von Seite zu Seite. Wer ist diese Frau? Warum will sie nicht gesehen werden? Schon bald ahnt der Leser, dass diese Reise ihre erste und letzte sein wird.
Einmal sollten ihre Jungen, Stanley und Kevin, das Meer sehen, das war ihr großer Wunsch. Die Mutter - ihren Namen und ihr Alter gibt sie nicht preis - kratzt die paar Münzen zusammen, die sie besitzt, insgesamt nur wenig mehr als fünfzig Francs, und steigt mit ihren Kindern in einen Bus. Es regnet in Strömen.
Hoffnung und Verzweiflung
Als sie am Urlaubsort ankommen, findet die Mutter nur mit Mühe das schäbige Hotel mit dem winzigen Zimmer, in dem sie sich zu dritt das Bett teilen müssen. Am nächsten Tag regnet es noch immer. Die drei gehen an den Strand, später in ein Café, dann zurück ins Hotel und zuletzt auf ein Volksfest. Stan, der ältere, kümmert sich rührend um seinen jüngeren Bruder; die Mutter, die psychisch krank ist, aber ihre Tabletten nicht dabei hat, ist dazu nicht in der Lage. Immer wieder klinkt sie sich aus der Gegenwart aus, dämmert im Bett vor sich hin und überlässt die Kinder sich selbst.
Fremd im eigenen Leben
Die Frau, die als Ich-Erzählerin Geschehene minutiös genau rekapituliert, ist mit ihrem Leben vollkommen überfordert. Sie kann kaum für sich selbst sorgen, auch die Kinder sind, wie ihr plötzlich auffällt, ziemlich verwahrlost. Schmerz, Trauer, Verwirrung - im Mittelpunkt ihrer Erzählung stehen ihre eigenen Gefühle, ihre ganz persönliche Wahrnehmung, die durch ihre psychische Krankheit verzerrt und unheimlich wirkt. Die Kinder haben eine Reise unternommen, sie haben das Meer gesehen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr... In Meeresrand, ihrem ersten Roman, leuchtet Véronique Olmi mit einer geradezu bedrückenden Eindringlichkeit und Unmittelbarkeit die Abgründe der menschlichen Existenz aus. (Birgit Kuhn)
Der erste Roman von Véronique Olmi ist einfach umwerfend... (L´Express)
Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Frau und ihren beiden Jungen, die mitten in der Nacht aufbrechen, um an ein kleinen Ferienort am Meer zu fahren. Dieses Unbehagen, das den Leser bereits auf den ersten Seiten erfasst, steigert sich von Seite zu Seite. Wer ist diese Frau? Warum will sie nicht gesehen werden? Schon bald ahnt der Leser, dass diese Reise ihre erste und letzte sein wird.
Einmal sollten ihre Jungen, Stanley und Kevin, das Meer sehen, das war ihr großer Wunsch. Die Mutter - ihren Namen und ihr Alter gibt sie nicht preis - kratzt die paar Münzen zusammen, die sie besitzt, insgesamt nur wenig mehr als fünfzig Francs, und steigt mit ihren Kindern in einen Bus. Es regnet in Strömen.
Hoffnung und Verzweiflung
Als sie am Urlaubsort ankommen, findet die Mutter nur mit Mühe das schäbige Hotel mit dem winzigen Zimmer, in dem sie sich zu dritt das Bett teilen müssen. Am nächsten Tag regnet es noch immer. Die drei gehen an den Strand, später in ein Café, dann zurück ins Hotel und zuletzt auf ein Volksfest. Stan, der ältere, kümmert sich rührend um seinen jüngeren Bruder; die Mutter, die psychisch krank ist, aber ihre Tabletten nicht dabei hat, ist dazu nicht in der Lage. Immer wieder klinkt sie sich aus der Gegenwart aus, dämmert im Bett vor sich hin und überlässt die Kinder sich selbst.
Fremd im eigenen Leben
Die Frau, die als Ich-Erzählerin Geschehene minutiös genau rekapituliert, ist mit ihrem Leben vollkommen überfordert. Sie kann kaum für sich selbst sorgen, auch die Kinder sind, wie ihr plötzlich auffällt, ziemlich verwahrlost. Schmerz, Trauer, Verwirrung - im Mittelpunkt ihrer Erzählung stehen ihre eigenen Gefühle, ihre ganz persönliche Wahrnehmung, die durch ihre psychische Krankheit verzerrt und unheimlich wirkt. Die Kinder haben eine Reise unternommen, sie haben das Meer gesehen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr... In Meeresrand, ihrem ersten Roman, leuchtet Véronique Olmi mit einer geradezu bedrückenden Eindringlichkeit und Unmittelbarkeit die Abgründe der menschlichen Existenz aus. (Birgit Kuhn)
Der erste Roman von Véronique Olmi ist einfach umwerfend... (L´Express)

Véronique Olmi knüpft Familienfesseln / Von Tilman Spreckelsen
Die Fahrt ist ein Fiasko: Gleich zu Beginn setzt ein Nieselregen ein, der bis zum Ende nicht mehr aufhören wird. Alles ist klamm, die Kleidung ebenso wie das scheußlichbraune ungeheizte Hotelzimmer im sechsten Stock, in den kein Lift fährt. Zudem lasten die Blicke der Einheimischen schwer auf der Reisegesellschaft, einer Mutter und ihren beiden Söhnen im Grundschulalter. Und als sie endlich das erklärte Ziel, den Strand, erreichen, führt ihr Weg in die Katastrophe: "Ich hatte mir geschworen, die Kinder sollten das Meer sehen", sagt ihre Mutter, die Erzählerin. Ob sie geahnt hat, was sie damit in Gang setzt, bleibt bis zuletzt unklar. Wie sie aber in seltener Konsequenz die Entwicklung vorantreibt, ist ebenso schrecklich wie faszinierend.
Die vierzigjährige Dramatikerin Véronique Olmi wagt viel in ihrem ersten Roman "Meeresrand". Sie erzählt die Geschichte einer enttäuschenden Reise aus der Perspektive einer psychisch überaus labilen Frau, mehr noch: Sie verleiht ihr eine Stimme, die vollkommen glaubhaft die Wahrnehmung der Welt unter den Vorzeichen einer umfassenden Lebensangst abbildet. Olmis Erzählerin, die ihre beiden Söhne Kevin und Stan allein erzieht, wird immer wieder von Attacken geplagt, die es ihr unmöglich machen, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Als sie in der fremden Stadt am Meer ankommen, muß die Erzählerin einen Fremden nach dem Weg zum Hotel fragen - eine fast unüberwindliche Hürde: "Jetzt hatte ich wieder diese Beklemmung, dachte ich, und das machte mir angst." Wenn sie sich überfordert fühlt, und dieses Gefühl überfällt sie wie aus dem Nichts, rollt sie sich im Bett zusammen und zieht die Decke über den Kopf. Ist keine Decke da, gibt es keine Möglichkeit, einer Begegnung auszuweichen, dann kommt es zu gespenstischen Situationen: "Der Hotelmanager schien auf mich einzureden, ich hörte ihn sehr fern, zwischen ihm und mir waren Tonnen von Watte, die schluckten alles, die Worte und auch die Luft, ich bekam keine Luft, ich hatte meine Medikamente nicht dabei."
Das wäre nicht zu ertragen, hätte Olmi ihre Erzählerin nicht auch mit einer gehörigen Portion List und Renitenz ausgestattet, die sie Sozialarbeitern, Ärzten oder den Lehrern ihrer Kinder gegenüber an den Tag legt, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Behörden und Institutionen sind ihre Feinde, die Schule ist ein Konkurrent um die Liebe ihrer Söhne, ein Ort, an dem die Jungen über ihre Mutter ausgehorcht werden. Man könne ja nicht überall gleich begabt sein, erwidert sie einer Sozialarbeiterin, die an ihrer Eignung zweifelt, die Kinder angemessen zu versorgen. Ist sie zornig, schneidet sie fremden Menschen heimlich Grimassen oder schmiedet Rachepläne.
Dabei ist sie sich der Blicke der anderen stets bewußt, und die Öffentlichkeit wird für sie zum Ort eines ewigen Spießrutenlaufens. Wer sich so ausgegrenzt fühlt, sucht Verbündete. Olmis Erzählerin findet zwei, die sich nicht recht dagegen wehren können: ihre beiden Söhne. In einer fatalen Mischung aus Autoritätsanspruch und Freundschaftswerben sucht sie nach Gemeinsamkeiten, die aus den drei Personen eine verschworene Gruppe machen sollen, um der Welt die Stirn zu bieten: "Wir sind bald da, sagte ich zu meinen Jungs, und obwohl er weinte, lächelte mir Kevin zu mit seinem löchrigen Lächeln, wie ich immer sage, weil ihm drei Zähne fehlen - eigentlich sind wir beide uns ganz ähnlich, mit unseren Lücken im Zahnfleisch, ich traue mich oft nicht zu lächeln oder zu lachen, ohne mir die Hand vor den Mund zu halten."
In diesem Bild, das Kevins Wachstum und den eigenen Verfall, die Milchzahnlücken und das schadhafte Gebiß einer Erwachsenen in eins bringen will, zeigt sich die immense Spannung, unter der die Erzählerin steht. Um der Söhne willen, die in einem Alter sind, wo sich das blinde Zutrauen in die Mutter allmählich verliert, fühlt sie sich permanent auf dem Prüfstand - diesem Druck wären auch stabilere Naturen als sie nicht gewachsen. Daß ihre Söhne, besonders der neunjährige Stan, an ihrer Fähigkeit zweifeln, den Alltag zu organisieren, spürt sie genau; sie weiß, daß beide nichts so sehr ersehnen wie die Normalität der anderen Familien. "Wir gehen in ein Café, sagte ich, aber die beiden sahen nicht sehr überzeugt drein, deshalb fügte ich hinzu, Wir werden etwas bestellen, und man wird uns bedienen! Sie sahen mich mit großen Augen mißtrauisch an, als hätte ich ihnen eine Riesenlüge aufgetischt." Und als sie, zum Beweis, mit kindlicher Freude eine Büchse mit erspartem Kleingeld auf das Hotelbett schüttet, zählt der ungesund vernünftige Stan die Münzen - sie reichen kaum für ein paar Getränke. Es sieht aus, findet seine Mutter, "als würde er etwas aufsammeln, das ich zerschlagen hatte, als würde er eine Dummheit gutmachen, das ist alles, was sie in der Schule lernen: mißtrauisch sein".
Das allerdings hat Stan, wie sich rasch erschließt, vor allem zu Hause gelernt, zusammen mit der Fürsorge, die er schon früh für seine Mutter entwickelt hat. Er bewacht ihren Schlaf, hält den lebhaften Bruder von ihr fern, wenn sie erschöpft ist, und sorgt umsichtig dafür, daß Kevin regelmäßig zur Schule geht. Im Gegenzug aber ist er nicht mehr wie früher bereit, ihre Autorität zu akzeptieren.
Diese Entwicklung kommt nun zum Abschluß, und in einer großartigen Szene, dem geheimen Zentrum des Romans, spielt das Meer, das die Familie endlich doch erreicht, die Hauptrolle. Denn in den unterschiedlichen Reaktionen auf den Ozean spiegeln sich nicht nur die drei klassischen Perspektiven auf das Meer, die spielerische, enttäuschte und entgrenzende, sondern sie machen auch offensichtlich, daß diese Familie nicht mehr als verschworene Schutzgemeinschaft funktionieren kann. Kevin beginnt rasch, eine Sandburg zu bauen, während sich die Erzählerin eingesteht, das Meer sei "nicht sehr einladend, und von dem Regen wurde auch nichts besser", dann aber tapfer mehr sich als Kevin mit dem Hinweis tröstet, "eigentlich" sei das Meer blau. Stan aber reagiert auf die Weite, wie die Erzählerin es nicht erwartet hätte: Er beginnt zu laufen, er flieht vor der familiären Misere. Und als die Erzählerin ihn einholt, schlägt dieses unnatürlich ruhige Kind in einem einsamen Akt der Auflehnung ihre Hand herunter.
Die Auflösung der Familie ist Olmis zentrales Thema als Dramatikerin. In ihren Stücken, in denen das Meer gegenständlich oder als Metapher nur selten fehlt, entwirft sie immer wieder Personen, die ihre Familie verlassen wollen oder diesen Schritt bereits getan haben, die an der Familie ersticken und doch unablässig damit beschäftigt sind, die Nähe, die sie zerstören wollen, zu reflektieren. So rät in "Magali" die Greisin Juliette, die seit vielen Jahren alleine lebt, im Beisein ihrer Tochter Magali einer jungen Frau: "Schaff dir nie Kinder an. Niemals. Du drückst ein Neugeborenes an dich, dann wächst es und klettert auf deinen Schoß, später, wenn es zu dir kommt, schlingt es seine Arme um deinen Hals, und da begreifst du. Du begreifst, daß dein Säugling eine Schlingpflanze ist, die gewachsen ist. Eine fleischfressende Pflanze." "Aber wir berühren uns nicht", fügt Magali hinzu.
Olmis Roman schildert im Gegenzug das verzweifelte Bemühen, den Erosionserscheinungen der Familie zu begegnen - bis zur letzten Konsequenz. Daß diese nicht ganz unvermittelt kommt, ist eine große Stärke des Romans, der immer wieder Signale aussendet, die den Leser nervös machen: Wenn die Erzählerin die Busfahrkarten "mit meinem letzten Hunderter" bezahlt, fragt man sich nach den Kosten für die Rückfahrt und die Unterkunft, bis man begreift, daß es diese Rückfahrt nicht geben wird; wenn die Stadt in literarisch tradierten Mustern dezent als Totenstadt gezeichnet wird, ahnt man das Scheitern des Ausflugs und die Wendung, die das Geschehen nach einem letzten Besuch auf dem Rummelplatz nehmen wird.
Olmi zeigt uns die von immer neuen Panikattacken gezeichnete Mutter aus nächster Nähe, ohne sich ihr identifikatorisch zu nähern. Vor allem aber gelingt es ihr, neben der Perspektive ihrer Erzählerin eine weitere aufscheinen zu lassen, die auch aus dem Bericht erwächst: den mitleidig hilflosen Blick des älteren Sohnes, der mit seinen neun Jahren schon alle Manöver der Mutter durchschaut und dem nichts bleibt als das zähe Warten auf die Möglichkeit zur Flucht. Daß ihn die Begegnung mit dem Meer zum vorschnellen Aufbruch verleitet, wird zum Verhängnis für die ganze Familie.
Olmis Erzählerin aber wünscht sich mit ihren Söhnen ein Verhältnis zur Welt, das dem Blick auf den Bildschirm eines Fernsehers gleicht: "Aus sicherem Abstand, ohne uns schmutzig zu machen, die Fernbedienung in der Hand, und bei der ersten Schweinerei hätten wir sie abgedreht."
Véronique Olmi: "Meeresrand". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Renate Nentwig. Verlag Antje Kunstmann, München 2002. 120 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Veronique Olmis Erzählung beginnt mit einer nächtlichen Fahrt ans Meer, und das, so die Rezensentin Katharina Döbler, spricht schon Bände, denn die Fahrt ans Meer sei geradezu ein Topos der französischen Erzählung. Sie sei - literarisch oder filmisch - das "natürliche Ende jeder Fluchtbewegung" und bedeute entweder "Erfüllung" oder "Untergang". Dass es in diesem Fall ein Untergang ist, wird ganz allmählich im inneren Monolog der Ich-Erzählerin offenbar, die mit ihren Kindern in einer Nacht- und Nebelaktion ans Meer gefahren ist, erzählt Döbler. Olmis "schlichte Sätze", die aber leicht "ins Schrille" verrutschen und kleinen Dingen "übergroße Bedeutung" verleihen, so Döbler, verlieren nach und nach an Glaubwürdigkeit und zeichnen das Bild eines "wahnhaften Realismus", der "Paranoia, Panik und Lähmung" bedeutet. Dies sei nicht der schöne, "rauschhafte" und so ungemein literarische Wahnsinn, sondern er wirke "irgendwie klein, blass und hässlich", was dem Roman aber einen "dunklen Zauber" verleihe. Und so werde der Strand nicht zum Sinnbild für unermessliche Weite, sondern für eine "klaustrophobische" Gefangenheit zwischen dem Meer und der Stadt. Gefallen hat der Rezensentin auch, wie sich die "Tristesse" durch die mütterliche Zuneigung erwärmt und "dynamisch" wird. Dies gibt der Erzählung eine ganz bestimmte "Temperatur", weil Olmi "überzeugend, schonungslos und suggestiv" erzählt und weder die Mutterliebe, noch den Wahnsinn "verklärt", lobt Döbler.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Der erste Roman von Véronique Olmi ist ganz einfach umwerfend ... Unmöglich, die zerstörerische Schönheit ihrer Sprache zu beschreiben, die intensiven Gefühle, die er beim Lesen hervorruft." (L'Express)
"Ein unvergessliches Buch!" (Stern)
"Beklemmend und virtuos erzählt." (Literaturen)
"Ein unvergessliches Buch!" (Stern)
"Beklemmend und virtuos erzählt." (Literaturen)