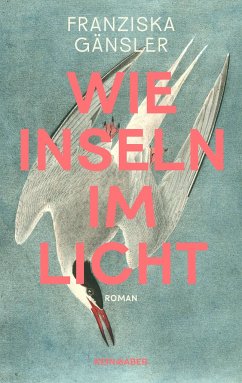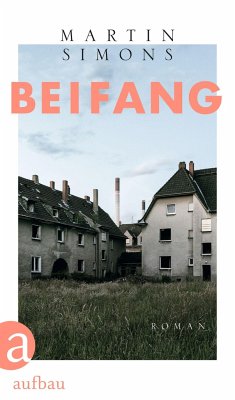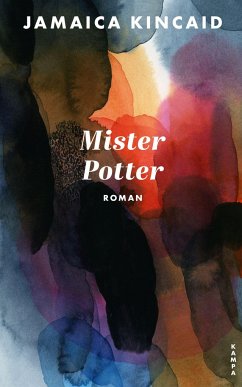Mein Bruder

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Es tut mir leid.« Das sind die Worte, die Jamaica Kincaid wieder und wieder hört, nachdem ihr jüngerer Bruder Devon 1996 an Aids gestorben ist. Sie erzählt von seinem Tod, nur um diese Worte zu hören. Dabei kannte sie ihn kaum. Erst drei Jahre alt war Devon, als Kincaid ihre Heimat Antigua verließ, um sich in den USA ein neues Leben aufzubauen. Zwanzig Jahre ist das her. Als sie erfährt, dass ihr Bruder schwer krank ist, reist sie zurück, zu ihm, nach Antigua, in die eigene Vergangenheit, in ein Leben voller Hoffnungslosigkeit und Armut - und stellt sich ihren Dämonen, den Verstrick...
»Es tut mir leid.« Das sind die Worte, die Jamaica Kincaid wieder und wieder hört, nachdem ihr jüngerer Bruder Devon 1996 an Aids gestorben ist. Sie erzählt von seinem Tod, nur um diese Worte zu hören. Dabei kannte sie ihn kaum. Erst drei Jahre alt war Devon, als Kincaid ihre Heimat Antigua verließ, um sich in den USA ein neues Leben aufzubauen. Zwanzig Jahre ist das her. Als sie erfährt, dass ihr Bruder schwer krank ist, reist sie zurück, zu ihm, nach Antigua, in die eigene Vergangenheit, in ein Leben voller Hoffnungslosigkeit und Armut - und stellt sich ihren Dämonen, den Verstrickungen ihrer Familie, der zerstörerischen Beziehung zu ihrer Mutter, für die Kincaid all die Jahre nur Abneigung empfinden konnte. Voller Zorn ist sie zwanzig Jahre zuvor auf und davon, wollte alles hinter sich lassen. Aber kann man das je? Nun findet sie allmählich ihren Frieden, kann Gegenwart und Vergangenheit miteinander aussöhnen.»Eines Tages geschieht vielleicht etwas, und dann werde ich verstehen, dass alles, was ich heute fühle, was keine Liebe zu sein scheint, in Wahrheit doch Liebe ist; dass ich meinen Bruder geliebt habe und die anderen, von denen ich abstamme.«Poetisch, ergreifend und mit großer Klarheit und eindrucksvoller Aufrichtigkeit erzählt Kincaid von Verlust und Abschied, von Hass und Liebe, Nähe und Distanz und den Illusionen, die unser aller Leben prägen. Aus der Verzweiflung wird Zuversicht, aus der Abrechnung die bewegende Geschichte einer Befreiung, einer Selbstfindung.