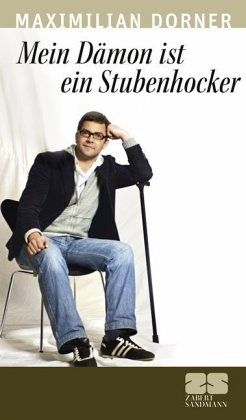
Mein Dämon ist ein Stubenhocker
Aus dem Tagebuch eines Behinderten
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
16,95 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Maximilian Dorner ist jung und begabt - und seit zwei Jahren ist er behindert. Das hat sein Leben von Grund auf verändert. In seinem Tagebuch schreibt er über die Fragen, die sein neuer Alltag ihm stellt: Schaffe ich den Weg bis zur nächsten Ampel? Wieso schäme ich mich vor mir selbst? Bin ich der Typ mit dem Stock oder der mit den sanften Augen? Warum ist mein Dämon ein Stubenhocker, der am liebsten im Tarnanzug schläft? Dorners Antworten sind mal mild und leise, mal traurig, oft sehr komisch und immer messerscharf beobachtet. Er hat ein besonderes Buch über einen zutiefst menschlichen...
Maximilian Dorner ist jung und begabt - und seit zwei Jahren ist er behindert. Das hat sein Leben von Grund auf verändert. In seinem Tagebuch schreibt er über die Fragen, die sein neuer Alltag ihm stellt: Schaffe ich den Weg bis zur nächsten Ampel? Wieso schäme ich mich vor mir selbst? Bin ich der Typ mit dem Stock oder der mit den sanften Augen? Warum ist mein Dämon ein Stubenhocker, der am liebsten im Tarnanzug schläft? Dorners Antworten sind mal mild und leise, mal traurig, oft sehr komisch und immer messerscharf beobachtet. Er hat ein besonderes Buch über einen zutiefst menschlichen Zustand geschrieben - in einem bisher unbekannten Tonfall.












