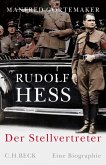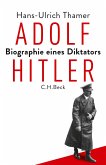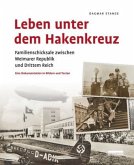Walter Gyßlings Erinnerungen und "Der Anti-Nazi", der die Hohlheit und wirklichen Absichten der hochkriminellen NS-Bewegung in ihrer ganzen Niederträchtigkeit offenbart, sind Zeugnisse eines anständigen Deutschen, der den wahren Charakter des Nationalsozialismus früh erkannte und als einer der bedeutenden und zu Unrecht vergessenen Warner des deutschen Volkes gelten muss. "Junge Deutsche", schreibt Arnold Paucker in seinem Vorwort zu diesem Buch, "müssten sich an den Kopf fassen, wenn sie sich vor Augen führen, welchen Verbrechern ihre Großeltern oder Vorfahren einst nachgelaufen sind." Die Würdigung des Lebenswerkes Walter Gyßlings dient zugleich der Durchschaubarmachung einer wichtigen Phase der deutschen Geschichte, sucht vor allem die jüngere Generation aufzuklären und ihr eine Warnung zu erteilen, die von bleibender Aktualität ist.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Das Buch "Der Anti-Nazi" brachte es auf 180000 Exemplare
Walter Gyßling: Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933 und Der Anti-Nazi: Handbuch im Kampf gegen die NSDAP. Herausgegeben und eingeleitet von Leonidas E. Hill. Donat Verlag, Bremen 2002. 504 Seiten, 25,40 [Euro].
Weit verbreitet ist die Auffassung, daß der Machtwille der Nationalsozialisten bis 1933 von den meisten Juden unterschätzt worden sei. Gebannt durch Traditionen und verharrend in der Illusion einer deutsch-jüdischen Symbiose, hätten viele die drohenden Gefahren einer nationalsozialistischen Herrschaft überdies verkannt, weil sie deren Lebensdauer als gering einschätzten. Die These vom weitgehend passiven deutschen Judentum wird widerlegt durch die Erinnerungen von Walter Gyßling und dessen "Handbuch im Kampf gegen die NSDAP". Leonidas E. Hill hat sie herausgegeben und mit einer gut lesbaren Einleitung versehen.
Wer war Walter Gyßling? Obschon die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin unter den Verfolgten des "Dritten Reiches" auch Gyßling aufführt, ist sein publizistischer Abwehrkampf gegen den Nationalsozialismus außerhalb der Forschung nur wenig bekannt. 1903 als einziger Sohn einer großbürgerlichen Unternehmer- und Offiziersfamilie in München geboren, trat er 1917 in das bayerische Kadettenkorps ein. Die Bekanntschaft mit dem Soziologen Müller-Lyer und dessen pazifistisch-freigeistigem Kreis, zu dem auch der Historiker Ludwig Quidde gehörte, entfremdete ihn jedoch schon bald dem nationalliberalen Milieu seiner Familie. Begeistert begrüßte er das Ende des Weltkriegs und die Revolution in München. Mit seinem Jugendfreund George Hallgarten, dem späteren Historiker, organisierte er die Ortsgruppen des "Kartells Republikanischer Studenten", um den völkisch-nationalistischen Tendenzen an den Universitäten entgegenzutreten. Dabei lernte er einen "unangenehm aggressiven Kommilitonen" kennen, "der für seine nationalsozialistische Alltagspolitik mit Gewalt nach einer pseudowissenschaftlichen Unterlage suchte": Rudolf Heß, Hitlers Adjutanten und späteren "Stellvertreter".
Das Studium der Rechtswissenschaften und Nationalökonomie mußte Gyßling 1923 aufgeben, da die Inflation das Vermögen seiner Eltern zunichte gemacht hatte. Er wurde Mitarbeiter der Münchener "Allgemeinen Zeitung", in der er einen "leidenschaftlichen Kampf gegen die politischen Schiebungen im Hitlerprozeß" führte, und verfaßte "Studien über die Psychologie der nationalsozialistischen Bewegung", die ihn mit dem "Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" in Verbindung brachten.
Im Auftrag des C.V. fuhr Gyßling in die regionalen Hochburgen der Nationalsozialisten, um deren soziale und ökonomische Basis zu analysieren und die Ursachen für die zunehmenden Wahlerfolge der NSDAP zu ermitteln. Er beobachtete die Redner und Propagandafeldzüge der NSDAP, wertete die auf seinen Erkundungsreisen gesammelten Materialien aus, erstellte Wähleranalysen und machte Vorschläge zur Bekämpfung der Nationalsozialisten. Gyßlings Erinnerungen legen Zeugnis ab vom Attentismus und der mangelnden Bereitschaft des Polizei- und Justizapparats, gegen nationalsozialistische Gewaltverbrechen vorzugehen. In vielen Kleinstädten konnten die Nationalsozialisten schon vor 1933 ihre Terrorherrschaft errichten, jüdische Geschäfte boykottieren, politische Gegner mißhandeln und ungestraft gegen behördliche Anordnungen verstoßen. So kam es zum Beispiel bereits 1930 in Mecklenburg zu schweren antisemitischen Ausschreitungen, die die dort lebenden Juden zwangen, ihre Heimat zu verlassen.
Die Erfahrungsberichte und Materialsammlungen flossen in ein Archiv, das Gyßling im Auftrag des "Centralvereins" unter dem Tarnnamen "Büro Wilhelmstraße" errichtete und sukzessive ausbaute mit dem Ziel, die Sozialstruktur, Ideologie und Agitationsformen der NS-Bewegung zu erforschen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse dienten zugleich als Grundlage für die Entwicklung einer antinationalsozialistischen Propaganda und zur Erprobung neuer Kampfmethoden gegenüber den Nationalsozialisten. Neben den großen Tageszeitungen wurden die periodischen Publikationen der NSDAP ebenso ausgewertet wie Literatur nationalsozialistischer Provenienz. Weitere Informationen gingen dem Archiv aus den regionalen Organisationen des "Centralvereins" und seinen Agenten zu, die Kundgebungen der NSDAP observierten und die dort gehaltenen Reden stenographisch protokollierten.
Anfang 1933 umfaßte das Archiv mehr als 800 Dossiers mit über 500 000 Stichworten. Auf dieser Materialbasis brachte Gyßling den "Anti-Nazi" heraus, der bis 1933 eine Gesamtauflage von 180 000 Exemplaren erzielte. Im Februar 1933, unmittelbar nach Hitlers Machtübernahme, wurde das "Büro Wilhelmstraße" vom "Centralverein" geschlossen und das Archiv nach Bayern verlagert, wo es in einer Papierfabrik der Vernichtung anheimfiel. Um der drohenden Verfolgung zu entgehen, floh Gyßling in die Schweiz, von wo er sich als Journalist für die "Basler Nachrichten" und die "National-Zeitung" weiterhin kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzte. Gyßling blieb Republikaner und Pazifist. 1974 war er Initiator des "Humanistischen Manifests", das die wichtigsten Positionen der Freidenker-Vereinigung vertrat.
Im Oktober 1980 ist Walter Gyßling in Zürich verstorben - weitgehend unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit. Seine Erinnerungen und der "Anti-Nazi" sind eine wahre Fundgrube nicht nur für Historiker und Journalisten, sondern auch für alle zeitgeschichtlich interessierten Leser, die wesentliche Gründe für den Aufstieg der NSDAP und den Untergang der Weimarer Republik erfahren wollen.
HANS-JÜRGEN DÖSCHER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Als "einfühlsames Porträt" Walter Gysslings (1903-1980), eines heute fast vergessenen Pioniers im Kampf gegen den aufkommenden Nationalsozialismus, würdigt der A.C. zeichnende Rezensent dieses Buch. Wie der Rezensent ausführt, warnte Gyssling, ein engagierter Humanist und streitbarer Geist, schon 1930 mit seinem "Handbuch im Kampf gegen die NSDAP" vor den Nazis. Dem Herausgeber Leonidas E. Hill ist es nach Ansicht des Rezensenten gelungen, "das Bild Gysslings treffend einzufangen". "Verdienstvoll" findet er insbesondere die erneute Publikation von Gysslings Schriften aus der Weimarer Zeit. "Heute wenden sich diese Frühschriften vor allem an eine jüngere Generation", erklärt der Rezensent abschließend, "die gegenüber den Versuchen neuer Totalitarismen hellhörig gemacht und davor gewarnt werden soll."
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH