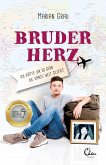Mein Vater, die Dinge und der Tod ist ein Buch über Trauer und Verlust, über eine Generation, eine Zeit, aber auch ein Buch, das erzählt, wie wir uns erinnern. »Ein Mensch lebt so lange, wie sich andere an ihn erinnern. Vielleicht denke ich deshalb häufiger an meinen Vater als zu seinen Lebzeiten. Weil die Selbstverständlichkeit seines Daseins fehlt. Was für Erinnerungen sind es? Was haben sie mit den Dingen seines Lebens zu tun, mit den Objekten, die ihn Tag für Tag umgaben? Je länger ich an meinen toten Vater denke, desto mehr sprechen seine Dinge zu mir.« Mein Vater, die Dinge und der Tod ist ein Buch über Erinnerung, wie wir es so noch nicht gelesen haben. Ein Buch über den toten Vater, ein Buch über eine Generation, über eine Zeit, aber auch ein Buch, das erzählt, wie wir uns erinnern. Wenn die Erinnerung spricht, sprechen die Dinge. Da ist der Sessel, der von der Fußballleidenschaft des Vaters erzählt, von den Nächten, in denen der Wecker gestellt wurde, um legendäre Boxkämpfe nicht zu verpassen. Da das selbst gemalte Ölbild an der Wand, das an eine Begabung des jungen Vaters erinnert, die in seinem Leben auf der Stecke blieb. Da die Uhr, ein Geschenk, das er zu einem Firmenjubiläum bekam, da der Bierkrug, der seine bayerische Herkunft wachrief ... In den Alltagsdingen vergegenwärtigt Rainer Moritz ein ganzes Leben, eine ganze Welt, besonders und unwiederbringlich. Dieses so liebevolle wie unsentimentale Portrait seines Vaters in seiner Zeit erzählt davon, wie wir uns vergewissern, wer wir sind, wenn wir mit dem Tod, mit dem Tod der Eltern konfrontiert werden.

Rainer Moritz betrachtet eine ganze Generation
Was du ererbt von deinen Vätern hast, beschreib es, um es loszulassen. Die materielle Spur, die ein geliebter Mensch hinterlässt, kann schließlich auch zum Ballast werden. Es bringt jedoch nichts, die emotionale Aufladung von Hinterlassenschaften zu ignorieren. Auch wenn alles Dingliche aus der Anonymität kommt und sich irgendwann wieder in diese zurückzieht, bilden die Gegenstände jahrelang Lebensgemeinschaften mit ihren Besitzern. In den unterschiedlich vergilbten Buchrücken einer Bibliothek etwa ist der Sammler noch präsent, selbst wenn er nicht mehr ist. Das gilt, wie der Autor dieses schönen Büchleins, selbst ein Homme de lettres, feststellt, nicht nur für Bücher, sondern für alles Angeeignete. Nach dem Tod ihres Besitzers gruppieren sich die trauernden Dinge noch eine Weile um eine abwesende Mitte, wie um ein Nachbild festzuhalten. Sie halten Ehrenwache. Besser also, man lässt sich darauf ein und schmeckt den Erinnerungen nach. Die Inventur, die Rainer Moritz im Elternhaus, einer rollladengesicherten Festung, vorgenommen hat, führt auf direktem Weg ins behagliche Jacobs-Krönung-Deutschland.
Der wortgewandte Leiter des Literaturhauses Hamburg hat schon über allerlei geschrieben: Fußball, Kulinarisches, Papiersex, das Wirtschaftswunder, Hotels, Literatur als Lebenshilfe, Lurchi und andere Helden des Südwestens. Das tut er stets mit schwungvoller Feder, und oft fließt Persönliches ein. Aber erst in diesem Buch ist der Autor ganz bei sich, stilistisch wie thematisch. Eine neue Gattung hat Moritz nicht erfunden. Die Idee der Annäherung an den Vater über dessen Besitztümer klingt konzeptueller, als sie ist. Dinge spielen in allen Memoiren eine zentrale Rolle, weil sie das Vergehen der Zeit dokumentieren. Zudem sind die hier durchmusterten Gegenstände nicht außergewöhnlich, im Gegenteil: ein abgewetzter Lieblingsfernsehsessel, die Automatik-Armbanduhr, ein Standaschenbecher mit Rotationsmechanismus, das sind Zeugen einer Epoche, keine individuellen Spleens. Aber der Autor vermag sie auf warmherzige Weise zum Sprechen zu bringen: "Die Armlehnen zeigen die Spuren jahrelanger Nutzung . . . Der Sessel hat sich ihm angeglichen, er gehörte zu ihm. Hier konnte ihm nichts geschehen."
Wir lernen einen bundesrepublikanischen Vorzeigebürger kennen, ein Familienoberhaupt, der Prinzipien über Moden stellte. Repräsentative "Anschaffungen" waren wichtig, aber keine Bauchentscheidungen. Markenware vom Fachhändler musste es sein. Mit leicht elegischem Ton wird erzählt, wie dieser auftrittssichere "Ernte 23"- und "Rasierwasser"-Mann, dem der Autor trotz gelegentlicher Bekanntschaften mit dem Teppichklopfer eine glückliche Jugend verdankt, allmählich zu einem Don Quichotte im eigenen Reich wurde - und wie er seinen Frieden damit machte, von seiner Frau, die offener für Veränderungen war, sogar das Internet für sich entdeckte, versorgt zu werden. Wie die meisten deutschen Senioren konnte der Vater nur ein Gericht kochen, "seine geliebten Schinkennudeln", aber nur, wenn alle Ingredienzien vorbereitet waren. Dafür ließ der Aufbackperfektionist niemand anderen an den Toaster. Schwäche zu zeigen war für Kurt Moritz keine Option: Im Alter blieb er lieber daheim, als sich durch einen Rollator zu erniedrigen. Der Bayer in Württemberg war insgeheim ein Preuße.
Ohne dass es aufgesetzt wirkt, weitet sich diese gewissermaßen haptische Rückschau von den Anekdoten zu einem Generationenporträt und zur Reflexion über letzte Dinge: "Danach kommt nichts - oder etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Das ist kein Grund, ständig zu klagen, es gehört dazu. Darüber nie zu klagen wäre merkwürdig." Das Buch ist aber auch eine Vermessung des Abstands, der die Post-Achtundsechziger von der Elterngeneration trennt, und dabei sind die erwartbaren politischen Diskrepanzen (der Vater schwor auf Franz Josef Strauß) das Unwesentlichste. Wichtiger scheint, dass für jene, die aus Ruinen kamen, die Wohnung und all das Zeughafte darin - von der "Lesekrippe" über die Durchreiche und die fehlkonstruierte Terrassentür bis zum handgesägten Kamm - eine Dignität besitzen, die den Nachgeborenen fremd blieb: ein Ort, "wo alles an seinem Platz war, wo die Dinge des Lebens sich behaupteten gegen alles, was sich draußen in der Welt tat".
Konsequent endet die Wanderung durchs Vaterland auf dem Friedhof, vor der neuen Wohnung des Vaters, wo man den alten Herrn - so gut kennt man ihn da schon - zu vernehmen scheint, wie er mahnt, wegen einer so unbedeutenden Sache wie dem Ableben nun bloß nicht die Fasson zu verlieren oder gar mit der Terrassentür zu rumpeln.
OLIVER JUNGEN
Rainer Moritz: "Mein
Vater, die Dinge und der Tod".
Verlag Antje Kunstmann, München 2018. 192 S., Abb., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main