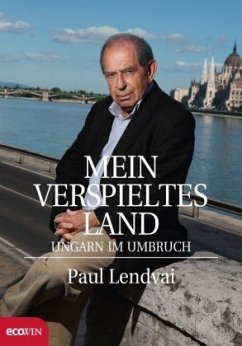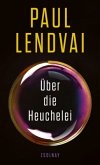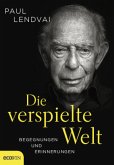Zwanzig Jahre nach der Wende erlebt Europa einen dramatischen Szenenwechsel in Ungarn. Zum ersten Mal wird das Land mit einer Zweidrittelmehrheit von einer national-rechtskonservativen Partei regiert. Die Rechtsradikalen stiegen zur drittstärksten Kraft im Parlament auf. Die Sozialisten haben die Hälfte ihrer Wähler verloren. Wie konnte der einst bewunderte Schrittmacher der Reformen in der kommunistischen Welt zum besorgniserregenden Krisenherd mit starken rechtsradikalen Kräften werden? Wird der Wahlsieger, Ministerpräsident Viktor Orbán durch einen nationalbetonten Kurs die zwischenstaatlichen Spannungen in Mitteleuropa verschärfen? Was ist der Hintergrund der starken fremdenfeindlichen, rassistischen und antisemitischen Töne in den Medien? Wird die neue Regierung die Wirtschaftskrise bewältigen und den weiteren Aufstieg der Rechtsextremisten verhindern können? Im Spiegel der Begegnungen mit Schlüsselfiguren aus Politik undWirtschaft, Kultur und Medien beschreibt Paul Lendvai,einer der renommiertesten Ostexperten Europas, Ungarn im Umbruch und bringt dem Leser die verblüffende Geschichte der letzten 20 Jahre seines Heimatlandes ohne Tabus und Vorurteile näher.

Paul Lendvai lässt an den Wahlverlierern ebenso wenig ein gutes Haar wie am Wahlsieger
Humor und Satire sind keine exakten Universalwissenschaften, sondern Kronzeugen der jeweiligen Leitkulturen. Worüber Dänen lachen können, finden Araber beleidigend und schlimmstenfalls todeswürdig. Wenn der Österreicher Paul Lendvai als Quintessenz seines jüngsten Buches über Ungarn den satirischen Aphorismus seines Landsmanns Karl Kraus zitiert: "Am Chauvinismus ist nicht so sehr die Abneigung gegen die fremden Nationen als die Liebe zur eigenen unsympathisch", dann mag er bei seinen deutschen Lesern gewonnen haben, doch bei den Ungarn hat er ein Problem. Denn die Liebe zur eigenen Nation ist den Magyaren so heilig wie zum Beispiel den Franzosen, die ihre großen Reden und ihre Feiern traditionell mit einem Hoch auf die eigene Nation beenden: "Vive la France!". Der deutschsprachige Raum ist mit seiner gegenwärtigen publizistischen Distanz zur eigenen Nation eher die Ausnahme denn die Regel in der Europäischen Union.
Lendvai betitelt sein Buch über "Ungarn im Umbruch" mit "Mein verspieltes Land". Wer es lesen will, fragt sich zunächst, ob er "verspielt" im Sinne des ebenso gedankenlosen wie folgenschweren Verlierens gebraucht oder von "unkonzentriert", "tändelnd" oder "kindisch". Doch Letzteres hat Lendvai nicht im Sinn, sein Befund ist eine bittere Abrechnung des gebürtigen Ungarn mit der Entwicklung seiner einstigen Heimat in den zwei Jahrzehnten seit der Wende von 1989. Die Enttäuschung des erfahrenen Journalisten ist auf jeder einzelnen Buchseite zu spüren. Doch der Enttäuschung ist wohl eine Täuschung vorausgegangen: die Annahme, mit der politischen Wende gehe eine massenhafte persönliche Wende einher, zum Beispiel der alle umfassende Verzicht auf Eigennutz und die Arm und Reich vereinigende Hinwendung zum Gemeinwohl.
Aktualität, ja Brisanz gewinnt das Buch nicht wegen der guten Porträts aus der Wendezeit, sondern wegen Lendvais Fundamentalkritik am jetzt wieder amtierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Ihn hält der Verfasser offenbar für einen gefährlichen Menschen, obwohl der Vorsitzende der Partei "Fidesz" in seiner ersten Regierungszeit von 1998 bis 2002 im europäischen Vergleich nicht als Belzebub gegolten hatte. Ausgangspunkt des Verdikts ist Orbáns Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament. Diese erlaubt es ihm tatsächlich, auf legalem Wege die Verfassung vollkommen umzugestalten - Verfassungsänderungen sind in Ungarn ebenso wenig den Entscheidungen des Volkes vorbehalten wie in Deutschland.
Wie es zur überwältigenden Mehrheit des Parteienbündnisses von Fidesz/Christlicher Volkspartei gekommen ist, dies beschreibt Lendvai in einer Art, die den Leser mehr verstört als aufklärt. Bringt man die Kernsätze des letzten Kapitels mit der Überschrift "Sieger im Endkampf - Orbán über alles" jedoch in die richtige Reihenfolge, dann wird die Wirklichkeit klarer. Nicht die Eigentümlichkeiten des ungarischen Wahlrechts sind schuld an dem großen Wahlsieg, wie es Lendvai eingangs suggeriert - vor vier Jahren hat Ministerpräsident Gyurcsány mit seiner Koalition aus Sozialisten und Linksliberalen den Vorteil aus dem Wahlsystem gezogen -, sondern die Vorgeschichte der Wahl, die Lendvai allerdings erst einige Seiten später in die Worte fasst: "In den Jahren zwischen 2002 und 2010 bot das sozialistisch-liberale Lager ein jämmerliches, ja zuweilen ekelerregendes Bild von Filz, Vetternwirtschaft und politischer Verkommenheit. Die total diskreditierten Sozialisten bilden für die absehbare Zukunft keine schlagkräftige Opposition. Die meisten linksliberalen Politiker allerdings haben sich jahrzehntelang in der Brutstätte der Korruption und in dem vor ihr genährten Klientelsystem bestens zurechtgefunden." Die Wähler von Fidesz würden dieser Aussage Lendvais voll und ganz zustimmen und hinzufügen: Genau dies hatte auch Orbán im Wahlkampf gesagt. Warum also die Aufregung über Orbáns Wahlsieg? Oder hätten die Wähler mehrheitlich auf die neue und unerprobte Partei LMP vertrauen sollen, um Orbán in die Schranken zu weisen. Eine Wahl braucht eine Alternative, es kann niemanden verwundern, wenn die bisherige Opposition gewählt wird. Oder hätten sich die Ungarn in die Wahlenthaltung flüchten sollen? Lendvai beanstandet, dass die Wahlbeteiligung "nur 64 Prozent betrug" und die auf Fidesz entfallenen Stimmen "rund ein Drittel der Wahlberechtigten und ein Viertel der Bevölkerung ausmachten". Wo in aller Welt wird das Wahlergebnis ernsthaft an der Gesamtbevölkerung eines Landes einschließlich der Kinder und Greise gemessen?
Dem Rätsel Orbán kommt Lendvai mit zwei Bemerkungen auf die Spur. Irgendwie nimmt er es dem Ministerpräsidenten übel, dass dieser "durch die Zerschlagung der Gruppe der unverbesserlichen Extremisten und durch, ,Inhalieren' der paktfähigen Aufsteiger aus dem Jobbik-Lager die Lufthoheit" zu gewinnen versucht - obwohl dies genau das Franz-Josef-Strauß-Rezept zum Umgang mit Extremisten ist. Freilich erkennt er an, dass der so beschriebene "offensiv-nationale und rechtskonservativ-klerikale Kurs" in der Bevölkerung "auf keinen Widerstand stößt". Andererseits hält er den Sozialisten ob ihrer "Zerstrittenheit" vor, dass sie "angesichts der linkspopulistischen und gegen die internationalen Finanzinstitutionen gerichteten Phraseologie des Ministerpräsidenten und seiner Partei" die Fidesz wohl auch nicht "von links überholen können". Orbán hat offensichtlich eine Masche gefunden, die großen Teilen der politisch zermürbten Bevölkerung gerade recht ist: "Über 70 Prozent der Befragten wünschen eine starke Regierung ohne Parteienhader und 50 Prozent sogar eine einzige dominante Partei." Dies allerdings bedeutet nicht, dass sich die Ungarn ein Einparteienregime wünschen, sonst hätten sie nicht den Aufstand gegen die Kommunisten gewagt und sofort ein Mehrparteiensystem eingeführt.
Lendvais Buch wartet mit vielen wissenswerten Einzelheiten auf und belohnt die Lektüre mit einer vertieften Kenntnis des Volkes, dem die Deutschen wegen der Ausreisegenehmigung für die DDR-Flüchtlinge stets verbunden und dankbar sein wollten. Der Leser darf dabei allerdings ebenso kritisch sein, wie es Lendvai bei der Beurteilung des gegenwärtigen Ungarn ist.
GEORG PAUL HEFTY
Paul Lendvai: Mein verspieltes Land. Ungarn im Umbruch. Ecowin Verlag, Salzburg 2010,233 Seiten, 23,60 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Michael Frank begrüßt dieses Buch von Paul Lendvai über "Ungarn im Umbruch". Er schätzt es als "erschrocken-zornige" Abrechnung mit den aktuellen Entwicklungen Ungarns. Eindringlich schildert der Autor für ihn, wie das Land seine gesellschaftliche und ökonomische Vorreiterrolle verspielt, um einem aggressiven Nationalismus zu huldigen. Dabei steuere es direkt auf einen neuen Totalitarismus zu. Deutlich wird in den Augen des Rezensenten dabei der Unterschied zwischen differenziertem Patriotismus und chauvinistischem Nationalismus. Er berichtet über die zahlreichen Anfeindungen von rechter Seite, denen Lendvai des Buchs wegen ausgesetzt ist. Franks Fazit: ein wichtiges Buch, das zur "Pflichtlektüre" für Europäer werden sollte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH