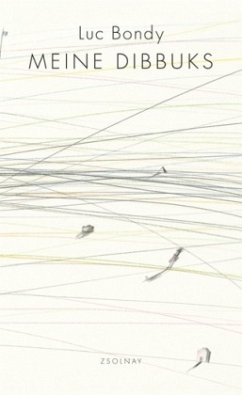Wie sind wir zu dem geworden, was wir sind? Was macht Freundschaft aus und wie hält man sich die toten und lebenden Dibbuks vom Leib, die von einem Besitz ergreifen wollen?
Luc Bondy erzählt von den Verlockungen und Schrecken der Kindheit, seiner Schulzeit im streng calvinistischen Internat, von zerbrechlichen Freundschaften und dem Tod des Vaters, von Künstlerfamilien und dem Alltag eines Regisseurs.
Prosaminiaturen, Dialoge und Erinnerungen eines großen Theatermachers.
Luc Bondy erzählt von den Verlockungen und Schrecken der Kindheit, seiner Schulzeit im streng calvinistischen Internat, von zerbrechlichen Freundschaften und dem Tod des Vaters, von Künstlerfamilien und dem Alltag eines Regisseurs.
Prosaminiaturen, Dialoge und Erinnerungen eines großen Theatermachers.

Federleichte Theatralik: Autobiographische Prosa von Luc Bondy
Sie haben einander zwanzig Jahre lang nicht gesehen, die Frau und der Mann, die einmal eine stürmische Liaison vereinte. "Du hast immer inszeniert", erinnert ihn Judith an die alten Zeiten, und es klingt, als würde er das heute auch noch tun. Aber in diesem Moment hat sie die Regie übernommen, denn sie läßt ihn zwar in ihre Wohnung ein, bleibt jedoch im Schlafzimmer verborgen. Die Unterhaltung wird ausschließlich und ohne Blickkontakt durch die angelehnte Tür geführt. Ein einziges Mal streckt sie die Hand heraus, um ein von ihm angereichtes Kleidungsstück zu ergreifen. Als es viel später dunkel geworden ist, bittet sie ihn, kein Licht einzuschalten, und schiebt ihn im Dunkeln hinaus: "Leb wohl!" Wollte sie dem einstigen Glück die Falten und Bitternisse ersparen, die sie beide verändert haben? Die Furcht vor der Enttäuschung scheint bei ihr größer zu sein als die vor der Einsamkeit, weshalb sie sich entschieden von ihrem früheren Liebhaber abgrenzt.
Mit "Ihre Sicht" endet Luc Bondys Erzählband "Meine Dibbuks", der im Untertitel "Verbesserte Träume" heißt. Der namenlose Mann in dieser letzten von fünfzehn Geschichten hat sich auf die Reise begeben, weil er "den starken Wunsch" empfindet, sich seiner Vergangenheit bewußt zu werden. Dieses Anliegen ist das zentrale Motiv des autobiographisch gefärbten Buches, in dem Bondy nicht ohne Koketterie die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verwischt.
Denn es ist schwierig, sich den berühmten Regisseur in manchen der geschilderten Situationen vorzustellen, nicht aber, wie er ihre Grundkonstellation schreibend so inszeniert, daß sie etwas über ihn und zugleich über ihn hinaus vermitteln. Einige Episoden sind eindeutig Bondys Vita zuzuordnen, andere umgarnen sie mit künstlerischer Freiheit und poetischer Autonomie.
Die Themen sind alltäglich: Konflikte zwischen Freunden, beim Erwachsenwerden - wie die schöne Zusammenfassung der Internatszeit in einem abgelegenen französischen Gymnasium an der spanischen Grenze -, in der Berufsausbildung, die als Privatschüler einer Pariser Schauspielerin anfing. Allerdings sind es keine hochglänzenden Memoiren, sondern - trotz des entspannten Sprechtempos sowie der nonchalanten Redeweise - Splitter mit rauhen Kanten.
Da trifft den Autor die Nachricht vom Tod seines Vaters, des 2003 verstorbenen Publizisten François Bondy, derart heftig, daß er im Taxi zum Krankenhaus Paß und Portemonnaie verliert, als hätten sich die Koordinaten seiner bürgerlichen Existenz erübrigt. Oder es sitzen drei ältere Männer in einem koreanischen Restaurant und haben vom Essen nichts, weil jeder mit seinen körperlichen Gebrechen - Erkältung, Erschöpfung, Diabetes - beschäftigt ist. Ohne Aufregung denkt Bondy an seine Krebserkrankung oder das Sterben des Malers und Bühnenbildners Gilles Aillaud zurück. Als die konfuse Trauerfeier im Schweigen erstarrt, hält er spontan eine Rede: "Zu einem Toten gehört eine Stimme. Jemand muß beweisen, daß es ihn, den Freund, gab."
Eine Art Selbstvergewisserung ist es auch, die Luc Bondy, 1948 in Zürich geboren, mit seinen Erinnerungen, Gedankenfetzen, Betrachtungen, atmosphärischen Skizzen, Nachrufen versucht. Er tritt sich wie der Welt neugierig, kritisch, sensibel und schutzlos gegenüber. Doch mit keinem Wort gibt er sich als der bedeutende, erfolgsverwöhnte Regisseur zu erkennen, der er seit vielen Jahren ist - und als Intendant der Wiener Festwochen überdies einer der international mächtigsten, da finanziell bestens ausgestatteten Theatermacher.
In diesem Kontext ist "Der Choreograph und der Schuh" als ein bemerkenswertes narratives Vexierspiel zu betrachten, in dem der zum Direktor eines Tanzfestivals beförderte Choreograph mit dem Amt seine Kreativität verliert. Er versteht die Künstler nicht mehr, die er einlädt, das Leben nicht, das er führt, und die Erde, wie sie sich inzwischen dreht. "Man muß vergessen, was einmal war", ruft er sich im Spiegel zu und wird nur noch trauriger.
Gerade bei einem Literaturexperten wie Luc Bondy ist es bedauerlich, daß zahlreiche verbale Nachlässigkeiten des auf deutsch verfaßten Bandes seitens des Verlages nicht korrigiert wurden, ob es um "die Zangen von einem Hummer" geht oder "Damals, wie sie von einer Stunde auf die andere nach Deutschland" gefahren war, ob jemand auftaucht, "der seine Sätze beginnt mit den Worten", oder plötzlich die Fälle verwechselt werden und es "mich" statt "mir" lautet: "Um dich mache ich mich gar keine Sorgen", heißt es einmal, oder "wie ich" beim Parodieren von Freunden und Bekannten deren spezifisches Gebaren, Macken, Gestik "aus mich herausschöpfte".
Indes gibt gerade diese Geschichte dem Buch den Titel. Darin berichtet der Autor von seiner Neigung zum Imitieren, die er nicht als Verhöhnung der kopierten Person betrachtet, sondern umgekehrt als Ausdruck der Gewalt, welche ein anderes Wesen über ihn gewonnen hat. "Der Dibbuk in der jüdischen Tradition", erklärt er, "ist ein Geist, die sündige Seele eines Toten, die in einen lebenden Menschen hineinfährt, ihn lenkt und auch verderben kann." Wenn sich ein Dibbuk in Bondys "Seelenpension" eingemietet hat, bewegt und fühlt er sich etwa wie Eugène Ionesco, dem er in Zürich als Übersetzer assistierte, oder wie der Argentinier Jorge Lavelli, bei dem er an der Theater-Universität von Paris studierte. Dabei verliert er sich, findet sich wieder, zieht offenen Auges und klopfenden Herzens dem nächsten Abenteuer entgegen. Mit der federleichten Theatralik, die seine Inszenierungen kennzeichnet, feiern Bondys Erzählungen das Dasein - als Sieg über die Schwerkraft.
IRENE BAZINGER
Luc Bondy: "Meine Dibbuks". Verbesserte Träume. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2005. 192 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Der Vergangenheit auf die Schliche zu kommen, schreibt Irene Bazinger in ihrer Rezension, sei das zentrale Motiv dieses "autobiografisch gefärbten" Erzählbandes, das Anliegen des Autors Luc Bondy. Bemerkenswert findet sie, dass dem Theatermann der Balanceakt zwischen biografischer Realität und poetischer Autonomie gelingt, wenn auch "nicht ohne Koketterie". Die Texte kommen daher als Erinnerungen, Betrachtungen, Skizzen, trotz des nonchalanten Tons, der federleichten Theatralik, die Bazinger sofort an die Inszenierungen Bondys erinnert, nicht als "hochglänzende Memoiren", eher wie "Splitter mit rauhen Kanten". Erleichtert konstatiert die Rezensentin Bondys neugierigen, kritischen und sensiblen Blick auf die Welt, in dem sich niemals "der bedeutende, erfolgsverwöhnte Regisseur" zu erkennen gibt. Ein Rüffel allerdings geht an ein eher lausiges Lektorat, dem Bazinger "zahlreiche verbale Nachlässigkeiten" nachweist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Mit der federleichten Theatralik, die seine Inszenierungen kennzeichnet, feiern Bondys Erzählungen das Dasein - als Sieg über die Schwerkraft." Irene Bazinger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.01.06 "Bondys Buch versammelt Erinnerungen an Tote, Krankheiten, Verluste, zerbrochene Freundschaften, an sexuelle Obsessionen und Leiden - alles, was hier so schwer klingt, ist von einer wundersamen Helle und Klarheit, von einer geradezu erschreckend heiteren Ironie, einem todeserfahrenen Sarkasmus getragen." Helmuth Karasek, DIE WELT, 15.10.2005 "Die Frage des Gleichgewichts. Wahrscheinlich ist ihm jener schwerelose, aber tragfähige Zauber zu danken, der dieses schmale, vielfältige und stoffreiche Buch durchzieht. Das Anliegen sind die Menschen und ihre kuriose Ernsthaftigkeit im Leben, welche Bondy weder mit Zentnerschwere belastet noch leichtfertig abtut, sondern beobachtend relativiert..." Barbara Villiger Heilig, NZZ, 18.10.2005 "Bondy inszeniert alle diese Traumspiele des vorbeifliehenden Lebens leicht, leise, intim, nahe am Ohr des Lesers, munter-elegisch, aber niemals klagend oder anklagend. Er sucht nicht nach Gründen, nach Schuldigen. Das Psychologisieren überläßt er den Ahnungslosen. Er schwadroniert nicht, verkündet nichts, hält sich nie im Allgemeinen und Sentenziösen auf." Gabriele Killert, DIE ZEIT, Oktober 2005 "Ein schönes, warmes kleines Buch." Sabine E. Dengscherz, Die Furche, 22.12.05