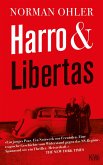Hans Frank, genannt "Der Schlächter von Polen", war Angeklagter im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, wo Tag für Tag die entsetzlichsten NS-Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhandelt wurden. Am 1. Oktober 1946 verurteilte das Gericht ihn zum Tod durch den Strang. Plötzlich waren die Franks herausgerissen aus Reichtum und Selbstherrlichkeit, in Armut und Verachtung gestürzt. Wie ging die Familie damit um? Und wie ging der daran Hauptschuldige Hans Frank damit um? Erstmals wird durch seinen Sohn Niklas die private Seite dieses Prozesses aufgezeigt, der die Weltgerichtsbarkeit auf eine neue Stufe stellte.Dieses Buch enthält den einzigartigen Briefverkehr zwischen der Gefängniszelle 15 in Nürnberg und den "Lieben daheim". Es zeigt der Welt, wie verlogen, sentimental, berechnend, kalt, grausig, aber auch liebevoll, verzweifelt, grotesk und auf schaurige Weise komisch Hans, Brigitte und ihre gemeinsamen fünf Kinder, dazu Omas, Opas und sonstige Verwandte mit den Folgen des Holocausts umgingen - und ihn verdrängten.Für Niklas Frank, das jüngste Kind, war der Tod seines Vaters am Galgen ein Lebenselixier: "Er konnte mir mein Hirn nicht mehr vergiften!"
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Josef Wirnshofer scheint gebannt von diesem Buch von Niklas Frank. Die Edition der Briefe zwischen dem Vater des Herausgebers, Hitlers Generalgouverneur in Polen, und seinen Angehörigen aus der Zeit der Nürnberger Prozesse findet Wirnshofer so mutig wie nötig. Die ganze Bigotterie des Hans Frank, der Umgang mit der Schuld und die Verdrängung innerhalb der Familie werden für den Rezensenten "unverstellt" sichtbar. Deutlich wird laut Wirnshofer auch die Wut des jüngsten Sohnes, der immer wieder einflicht, was die Taten seines Vaters und seine Familiengeschichte mit ihm machten. Die Diagnose am Ende des Buches überrascht Wirnshofer nicht: Die Schuld wurde von den Deutschen nie wirklich anerkannt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH