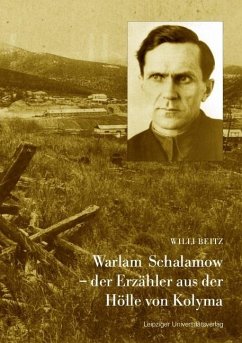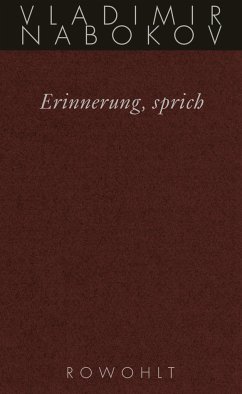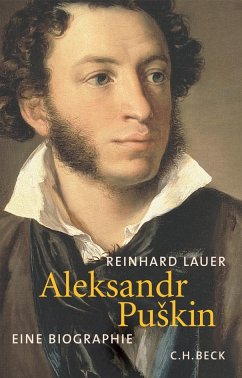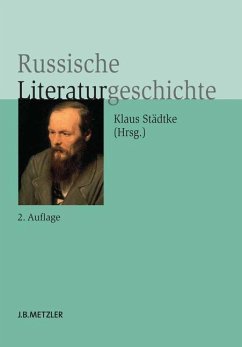Meine futuristischen Jahre
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
16,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Roman ]akobson (1896-1982), einer der bedeutendsten Sprachwissenschaftler des letzten Jahrhunderts, war kein Linguist, der im Gehege seiner Fachrichtung verharrte. Er beherrschte acht Sprachen und war ein Mann des weiten Horizonts, der scheinbar Disparates zusammenfügte, um die menschliche, Sprache in all ihren Aspekten zu erforschen. Er bewegte sich auf so unterschiedlichen Terrains wie Folklore und Relativitätstheorie, Malerei und Neurologie, Poesie und Kybernetik. In den Erinnerungen Meine futuristischen Jahre kehrt Jakobson in die historisch und künstlerisch dramatische Zeit Rußlands z...
Roman ]akobson (1896-1982), einer der bedeutendsten Sprachwissenschaftler des letzten Jahrhunderts, war kein Linguist, der im Gehege seiner Fachrichtung verharrte. Er beherrschte acht Sprachen und war ein Mann des weiten Horizonts, der scheinbar Disparates zusammenfügte, um die menschliche, Sprache in all ihren Aspekten zu erforschen. Er bewegte sich auf so unterschiedlichen Terrains wie Folklore und Relativitätstheorie, Malerei und Neurologie, Poesie und Kybernetik. In den Erinnerungen Meine futuristischen Jahre kehrt Jakobson in die historisch und künstlerisch dramatische Zeit Rußlands zwischen 1910 und 1920 zurück. Er schildert die Aufbruchsstimmung in Moskau und St. Petersburg, den Hunger nach neuen Formen in Malerei und Poesie und den "Gärungs"-Prozeß, aus dem der russische Futurismus hervorging. Während sich in der Malerei Farbe und Form aus dem Korsett des Realismus befreiten, lösten die russischen Futuristen das Wort aus der Klammer der Bedeutung und schufen eine "Zaum" genannte Sprache. An ihr schärfte der russische Formalismus seine theoretischen Instrumente. Jakobsons Sprachwissenschaft, die Strukturalismus, Phonologie und Semiotik antizipierte, entstand in diesem Kontext. Der Wissenschaftler, der zugleich Poet war, erzählt von seinen Begegnungen und Freundschaften mit den Dichtern Chlebnikov, Krucënych, Majakovskij und Pasternak, den Malern Malevic, Larionov und vielen anderen, die die russische Kunst jener Jahre bestimmten. Er zeichnet anekdotenreich und stets nobel im Ton ein lebhaftes, bisher fast unbekanntes Milieubild, zu dem nicht zuletzt auch die Liebesgeschichte von Osip Brik, Lilja Brik und Vladimir Majakovskij gehört. Jakobson mochte Memoiren nicht, seine Erinnerungen sprach er im Alter von 81 Jahren auf Band. Der schwedische Slavist Bengt Jangfeldt, der ihn befragte, stellte die Aufnahmen zu einem Text zusammen und kommentierte ihn ausführlich. Die Aufzeichnungen liegen hier erstmals in deutscher Sprache vor.