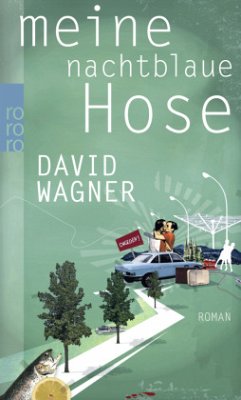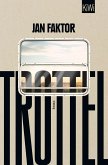"Mit den Dingen des täglichen Lebens geht Wagner so liebevoll um wie vor ihm nur Nicholson Baker." -- Die Welt
Aus einem verschwundenen Zauberreich - dem Westdeutschland der siebziger und achtziger Jahre
Für die allermeisten ist eine Hose nicht viel mehr als ein Stück Stoff. Nicht so für den Ich-Erzähler dieses außerge-wöhnlichen Romans. Vielleicht liegt es daran, dass er an jenem Tag, als er seine nachtblaue Hose erstmals trägt, eine junge Frau kennenlernt. Eine Berliner Liebesgeschichte schließt sich an, eine Reise an den Rhein und in die Kindheit einer Generation.
«So war sie, die Bundesrepublik, so wie sie der Held in David Wagners Debütroman erinnert. Mit Leichtigkeit, Witz und großer sprachlicher Begabung erzählt.» (DIE WELT)
«Raffiniert konstruiert, sprachlich geschliffen und sehr unterhaltsam.» (FOCUS)
Aus einem verschwundenen Zauberreich - dem Westdeutschland der siebziger und achtziger Jahre
Für die allermeisten ist eine Hose nicht viel mehr als ein Stück Stoff. Nicht so für den Ich-Erzähler dieses außerge-wöhnlichen Romans. Vielleicht liegt es daran, dass er an jenem Tag, als er seine nachtblaue Hose erstmals trägt, eine junge Frau kennenlernt. Eine Berliner Liebesgeschichte schließt sich an, eine Reise an den Rhein und in die Kindheit einer Generation.
«So war sie, die Bundesrepublik, so wie sie der Held in David Wagners Debütroman erinnert. Mit Leichtigkeit, Witz und großer sprachlicher Begabung erzählt.» (DIE WELT)
«Raffiniert konstruiert, sprachlich geschliffen und sehr unterhaltsam.» (FOCUS)

David Wagners Romandebüt "Meine nachtblaue Hose" / Von Alexandra M. Kedves
Tausend Namen, tausend Geschichten, tausendundeins Geheimnisse: Das Telefonbuch ist mittlerweile so etwas wie der letzte Hort der Metaphysik. Da hängt an jeder Zeile ein verborgenes Geknäuel - neudeutsch: Rhizom - aus Wünschen, Träumen, Enttäuschungen, und wer Lust hat, denkt sich was dabei. Und David Wagner hatte Lust. Gemeinsam mit zwei weiteren Berliner Jungautoren feierte er vor zwei Jahren in seiner "Telefonbuchlesung" die Ästhetik der aleatorischen Ahnungen und Abschweifungen. Nun hat er sie in seinem Debütroman "Meine nachtblaue Hose" buchstäblich in eine salonfähige Garderobe gesteckt. "Jede Hose war anders, weshalb ich mich hin und wieder bei irgendeiner unbeabsichtigten Bewegung - einer Bewegung, die sich im nachhinein selten rekonstruieren ließ - an eine Begebenheit erinnerte, die sich ereignet hatte, als ich eine ganz bestimmte Hose trug."
Viele Hosen und noch mehr Erinnerungen. Der Hosenstoff rutscht über die Haut, in einer raschen Drehung schwingt der Saum vergangenheitsschwanger mit, und schon sind sie wieder da: Augenblicke, ganze Tage, und ihre Stimmungen, heraufbeschworen durch die Madeleines aus Cordsamt, Jeans oder Schurwolle. Beim nächsten Rascheln des Schlags allerdings versinkt die wiedergefundene Zeit im Vergessen und macht einer weiteren kleinen Auferstehung Platz.
Und noch mehr Erinnerungen: Geschichten aus alten Zeiten erzählen nicht nur die Hosen, sondern alles, was ins Blick-, Hör- oder Riechfeld unseres Helden fällt. Wenn er sich etwa nebenbei mit der Serviette über die Lippen tupft, bleiben, zusammen mit den Waschpulveraromen, mentale Krümel aus zwei, drei Jahrzehnten kleben - die Haushälterin Frau Ops, ihre Klementine-Sprüche und ihre Klementine-Schürze, Muttersätze, Vaterrefrains, Tonspuren, Sommertage voller Wäscheleinen, Wäscheklammern, die auf den Fingerspitzen sitzen, Sissi de Maas, Fernsehwelten, Kinderwelten, "Ich bin Hui Buh, das Schlossgespenst", Waren-Wahrheiten. Eine Kindheit im Westen eben. Der 1971 im Rheinland geborene Autor schickt seinen Ich-Erzähler mit neuer Freundin von Berlin nach Köln und Bonn, zurück in die Heimat der beiden, dorthin, wo einst ihre Rollen und ihre Charaktere gebastelt wurden. Er hat sie zurückbuchstabiert wie die Republik zum Vor-Wende-Provisorium. Und wie die Eltern, in deren Plattenschrank die Beatles vor sich hinstauben wie ihre Ideale.
Die Freundin, die sich in ihrer Ostberliner Wohnung einen Puma-Adidas-unbeleckten Mann von drüben hält, trägt im Elternhaus brav Rock und Brille, und irgendwann finden im alten Kinderzimmer Doktorspiele statt; "mich störte nicht, dass wir bestimmt schon viel jünger als dreizehn geworden waren", kommentiert der Erzähler diesen Jungbrunnen zum Anfassen. Aber trotzdem werden die zwei Frischverliebten allmählich zu jung füreinander. Und zu ähnlich. Oder unterschiedlich - wie seine Eltern, die sich scheiden ließen, als er klein war. Am Ende der Reise landen die leidenschaftliche Ethnologie-Studentin und der bummelnde Jura-Student in einer Umkleidekabine: Sie probiert entschlossen eine schwarze Hose, während er seine nachtblaue kaum herunterbekommt. Da weiß sie es auf einmal: "mit uns beiden, das wird nichts". Worauf er überlegt, ob er jetzt "ich nehme die Hose" sagen sollte "oder eher etwas Unpassenderes wie ich liebe dich oder ich liebe dich nicht mehr".
Pfeile werden längst keine mehr abgeschossen, keine amourösen, keine bitterbösen: Das Debüt David Wagners kultiviert jene Décadence, die zu müde ist zum Glitzern und zum Spotten; die gerade noch lebt, wenn auch sonst nichts lebt. Jugendjahre unter Bonns Bourgeoisie der Achtziger, mit Klavier-Traktieren, Hund-Ausführen, Patchwork-Familien-Pathologisieren. Tennessee Williams' süßer Vogel Jugend war nie da, auch die Endstation Sehnsucht ist ein Luftschloss. Élegance dégagée könnte das genannt werden, was Wagner immer wieder glückt, wenn seinem Helden alles danebengeht. Er trifft den Ton für das Leben in Zuckerwatte, das am Finger pappt und im Mund zergeht wie - Nichts.
"Ich hörte den Regen ans Fenster tropfen und erinnerte mich an Eis auf Erdbeerspiegel, an Minzblätter auf Mousse aus weißer und schwarzer Schokolade und an heiße Himbeeren, die ich unter den Augen meiner Verwandtschaft vorsichtig essen musste . . . Aber an den Nachtisch am Vortag erinnerte ich mich nicht. Es gab keinen Kuchen, keine Linzer-, keine Großvaterschokoladentorte, dachte ich, meine Beine schliefen langsam ein." Und die Tristram-Shandy-Uhr tickt: Wagner zieht seine Knäuelästhetik durch und hat an fast alles gedacht. Nur nicht daran, auch mal ein Bonbon, ein Bonmot liegen zu lassen. Dabei hätte gar niemand mehr fragen brauchen, "wie kommt man aus seiner Verpuppung heraus, aus dem Kokon von Kunststoffkindheit, Nutellakindern, Niveatöchtern?", und niemand hätte mehr klagen brauchen über sein "eingeschweißtes, westdeutsches Leben", in dem Tortenstücke ausschauen wie Zierfische im Süßwasseraquarium.
Allein, der sprachverliebte Autor hat eine Botschaft und setzt auf jedes Sahnehäubchen eins drauf. Sein Rhein ist eine "Kunststoffschlange", sein Protagonist jobbt beim Onkel in der Kunststoffabrik, das Etikett der neuen Hose hängt an einem Kunststoffaden. Mit von der Rheinpartie sind tote Fische, tumbe Hunde, Mütter, die "iss, Kind" drängeln, Ossies "vorher" und "nachher" und was sonst auf den Karten eines jungen, bundesdeutschen Gruselmemorys drauf ist. Selbst hyperbolisch grinsend macht das wenig Spaß - und manchmal ist die Entdeckung der Langsamkeit lähmend. So stapeln in der Pause zwischen einem Schluck Kaffee und einem Biss ins Erdbeermarmeladebrot die leitmotivischen Souvenirs: Der triste Taugenichts sieht seinen Vater, einen Ministerialbeamten, beim Marmeladeeinkochen, er hört ihn am Keramikkochfeld der Einbauküche über Chemie dozieren und die Mutter über Zahnlöcher nölen. Aber wenn einer aus tausendundeins Erinnerungsfädchen einen rechten Roman schreiben kann, ist das schon eine ganze Menge.
David Wagner: "Meine nachtblaue Hose." Roman. Alexander Fest Verlag. Berlin 2000. 187 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Der Debütroman des Berliner Jungautors, der "aus tausendundeins Erinnerungsfädchen" besteht, hat Alexandra M. Kedves, so scheint es, unterhalten, wenn auch nicht begeistert. Dass nicht nur an den jeweiligen Beinkleidern ganze Wortkaskaden der Erinnerung hängen und dann auch losbrechen dürfen, sondern auch an allem, wirklich allem anderen sich Szenen erinnern lassen aus Familie, Kinderzimmer und Klavierstunden, will sie gerne glauben, und auch, dass in diesem Leben alles vorwiegend aus Kunststoff ist (selbstredend auch die Hosen). Aber letztlich hat die jungberliner "Décadence" sie trotz des beeindruckenden Aufwands wohl eher ermüdet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH