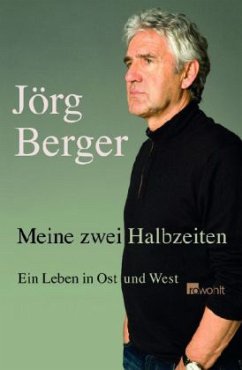Eigentlich ist Jörg Berger gerade dabei, in der DDR als Fußballtrainer Karriere zu machen. Da entschließt er sich 1979 zu einer waghalsigen Flucht in die Bundesrepublik. Warum er dem Arbeiter- und Bauernstaat den Rücken gekehrt hat, mit welchen Schwierigkeiten er im Westen kämpfen musste und wie ihn sein altes Leben weiter verfolgte - davon erzählt er in diesem Buch. Offen und ohne Bitterkeit, aber auch lebendig und voller Anekdoten: deutsch-deutsche Geschichte aus der Sicht eines Sportlers.

Jörg Berger - der Wunsch nach Freiheit und Tagen, an denen Fußball wirklich Nebensache wird
Als die Mauer fällt, ist Jörg Berger: beim Fußball. Ein Donnerstagabend im November, Flutlichtspiel auf dem Betzenberg, Kaiserslautern gegen Köln. Berger, damals Trainer von Eintracht Frankfurt, ist zur Spielbeobachtung angereist. Doch an diesem Tag gerät der Beruf für ihn zur Nebensache. Anders als seine Mitfahrer, zwei Reporter des "Kicker", die sich auch in dieser historischen Stunde nicht aus ihrem Alltag reißen lassen, ist er in Gedanken nur bei den Ereignissen in Ost-Berlin. Im Autoradio hat er Günter Schabowskis Ankündigung der neuen Ausreiseregelung gehört - er nimmt sie mit gemischten Gefühle auf. Berger wähnt das SED-Politbüromitglied "besoffen oder unter Drogen", kann nicht glauben, dass dieser Staat, den er ja ganz anders kannte, seine Bürger kampflos freigeben würde. Schon in den Wochen vor dem 9. November hat er die Montagsdemonstrationen, die in Leipzig erst Hunderte, dann Zehntausende Menschen auf die Straßen führten, mehr mit Sorge als mit Hoffnung verfolgt. Schließlich lebt dort noch sein Sohn Ron, und der nimmt, nach allem, was Berger weiß, rege an den Protesten teil.
1989 und der Mauerfall, das sind in diesem Jahr die Bezugspunkte für die kollektive Erinnerung an die deutsche Teilung und ihre Überwindung. Und natürlich ist auch für Berger diese Festnacht unvergesslich, zumal sie, entgegen seinen Befürchtungen, friedlich verlaufen ist. Doch 2009 jährt sich für ihn auch eine andere, eine noch größere Zäsur in seinem Leben. Vor 30 Jahren, im März 1979, nutzte der damals 34 Jahre alte Trainer eine Reise der DDR-Jugendnationalmannschaft nach Jugoslawien zur Flucht in den Westen. Es war das Ereignis, das sein Leben aus heutiger Sicht in zwei Hälften teilte, und so liegt es nahe, dass er seine Autobiographie mit dieser wagemutigen Flucht beginnt: von Subotica in der Vojvodina, wo er sich von der DDR-Delegation absetzt, über Belgrad und die westdeutsche Botschaft nach Österreich und schließlich in die Bundesrepublik.
In der vergangenen Woche hat Berger das Buch ("Meine zwei Halbzeiten") auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt. Leipzig war sein besonderer Wunsch. Die "Heldenstadt" von 1989 ist für ihn vor allem Heimatstadt. Dort ist der heute 64 Jahre alte Berger aufgewachsen, bei Lok Leipzig hat er es als Spieler bis in die Oberliga, die höchste Spielklasse der DDR, gebracht. An der Deutschen Hochschule für Körperkultur hat er seinen Trainerschein gemacht und seine erste Frau kennengelernt. Familie, alte Freunde - viele bekannte Gesichter sind zur Präsentation ins Zeitgeschichtliche Forum gekommen. Ein "ganz besonderer Tag" sei es deshalb für ihn, sagt Berger. Er sieht gut erholt aus. Die Chemotherapie, die er wegen einer Krebserkrankung vor kurzem machen musste, ist ihm nicht mehr anzumerken. Nach den eineinhalb Stunden allerdings ist er "nass geschwitzt wie damals auf der Flucht".
Der Wunsch nach Freiheit - wie für so viele DDR-Bürger war das auch für Berger das treibende Motiv, seinen Staat zu verlassen. Erst waren es Kleinigkeiten im Alltag eines Jugendlichen: der Ärger, weil er eine Jeans zum FDJ-Hemd trug, Mäkelei an seiner Frisur (Koteletten!), später ging es vor allem darum, wie sich der Staat und die Sportführung in seine Lebens- und Berufsplanung einmischten. "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr über mein Leben entscheiden konnte", sagt Berger heute. Zum "Bruch mit dem System" kommt es im September 1976. Kurz vor der Abreise zu einem Länderspiel in der Bundesrepublik erfährt er, dass er die Mannschaft nicht begleiten darf, weil die Nomenklatura seine Loyalität anzweifelt. Mehr als das schmerzt ihn, dass er seine Spieler über den wahren Grund belügen muss. Den unmittelbar anschließenden Anwerbeversuch der Stasi hält er für kalkulierend und perfide und lehnt ab. Drei Jahre darf er daraufhin nicht ins westliche Ausland reisen - die erste Gelegenheit nutzt er sofort.
Dort hat allerdings "niemand auf ihn gewartet", wie seine Mutter ihm beim Abschied prophezeit hatte. Es beginnt schon damit, dass man ihn, den diplomierten Nationaltrainer, beim Deutschen Fußball-Bund "wie einen Anfänger" behandelt. Auch mit manchem halbseidenen Klubpräsidenten in der Fußballwelt der 80er Jahre hat Berger so seine Probleme. In der Branche genießt er bald den Ruf eines "Feuerwehrmannes", der schon verloren geglaubte Mannschaften vor dem Abstieg retten kann - wie in Köln, Schalke oder, im besonders spektakulären Saisonfinale 1999, die Frankfurter Eintracht. "Am Anfang gefiel mir das nicht", sagt er, "aber dann habe ich gemerkt: Ein Image ist besser als keins." Es verschafft ihm stets aufs Neue einen Job. Auf 15 Stationen bringt Berger es nach seiner Flucht.
Dass er nicht zur Ruhe kommt, hat aber noch einen anderen Grund: Auch in der neuen Heimat bleibt der alte Staat auf mitunter unheimliche Art präsent. Zum einen plagen Berger Sorgen um die Familie. Seine Eltern, die erst später in den Westen nachkommen, und sein Sohn sind in der DDR, wie in Fällen von "Republikflucht" üblich, Repressalien ausgesetzt. Vor allem der heranwachsende Ron wird "wie der Sohn eines Verräters behandelt" und wird unter anderem aus seiner Fußballmannschaft "ausdelegiert". Vor allem die Gedanken an seinen Sohn lassen ihn an seinem Handeln, das ja auch ein egoistischer Akt gewesen war, zweifeln. Zudem wird er auch im Westen von der Staatssicherheit bearbeitet - und zwar "aggressiv", wie es in der Sprache der Behörde heißt. Eine nächtliche Begegnung mit zwei Stasi-Agenten, zerstochene Reifen am Auto, ein verlorenes Rad - das alles macht Berger stutzig. Das volle Ausmaß aber wird ihm erst viel später, nach dem Studium seiner Stasi-Unterlagen, bewusst. "Ich habe Glück gehabt, dass ich lebe", sagt Berger, der sich rückblickend "mehrmals in Lebensgefahr" wähnte.
Versuchte Entführung und Vergiftung - damit ist das Buch in den vergangenen Wochen auch zu einem Medienereignis geworden. Doch auch wenn bekannt ist, dass die Stasi vor derlei Abscheulichkeiten nicht zurückschreckte: Bei der Lektüre hätte man sich in beiden Fällen etwas handfestere Belege gewünscht, als Berger sie liefert. Ansonsten aber überzeugt das Buch, weil es sich auf eine sehr persönliche Perspektive beschränkt. Manche der vielen Anekdoten bietet einen wohltuend offenen und ausgewogenen Blick auf Alltag und Fußball - im Osten wie im Westen. Sich selbst schont er dabei nicht. Berger, der Egoist und Lebemann - auch das ist eine Klammer, die die beiden Halbzeiten seiner Biographie zusammenhält.
An einem lässt Berger keinen Zweifel: dass sein Entschluss, die DDR zu verlassen, letztlich richtig war. "Das war der Unterschied zwischen Freiheit und Freiheit", sagt er. "Im Westen konnte ich das erste Mal selbst entscheiden, was ich mache."
CHRISTIAN KAMP
Jörg Berger: Meine zwei Halbzeiten. Ein Leben in Ost und West. Rowohlt Verlag, 270 Seiten, 19,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main