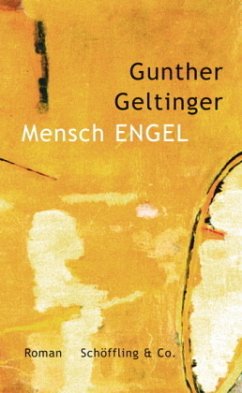Leonard Engel steht an einem entscheidenden Punkt seines Lebens: Die geliebte Kindheit in Mainfranken ist vorbei, das Abitur bestanden, die Zukunft voller Möglichkeiten, doch die erste Liebe zu seinem Freund Marius weicht schnell einer großen Leere und dem Gefühl, dass mit ihm "etwas Grundsätzliches nicht stimmt". Aus erotischen Verwirrungen und inszenierten Exzessen flieht er zum Studium nach Wien, wo ihn die Intrigen seiner Leidensgenossin Feline in die Arme des Strichers Tiago treiben. Weder ein Sprung in die Donau noch der Aufbruch zur Schwester nach Südfrankreich verheißen einen Ausweg aus dem Alptraum. Erst in der Begegnung mit Boris findet die rastlose Suche ihr Ziel. Besessen von dem Wunsch, mit diesem Menschen sein Leben zurückzuerobern, beginnt er, seine Geschichte aufzuschreiben.
Es entsteht das leidenschaftliche Selbstportrait eines jungen Mannes, der unter den Menschen, im Reich der Tiere und in der Welt der Engel gleichermaßen seine Wahrheit sucht und dabei ganz nebenbei erzählt, warum das Leben eigentlich nicht zu bestehen ist, und wenn doch, dann nur mit Hilfe der Literatur.
Es entsteht das leidenschaftliche Selbstportrait eines jungen Mannes, der unter den Menschen, im Reich der Tiere und in der Welt der Engel gleichermaßen seine Wahrheit sucht und dabei ganz nebenbei erzählt, warum das Leben eigentlich nicht zu bestehen ist, und wenn doch, dann nur mit Hilfe der Literatur.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Ina Hartwig ist von Gunther Geltingers Debütroman "Mensch Engel" sehr beeindruckt, und das, obwohl sie dem Autor unumwunden beipflichtet, es handele sich um ein "uncooles" Buch. Der Roman ist das Ergebnis einer Selbsterforschung durch den alles Normale verabscheuenden Leonard Engel, der darunter leidet, nicht lieben und nicht schlafen zu können und sich zudem regelmäßig selbst verletzt, erzählt die Rezensentin. Großartig findet sie, wie der Autor Engels Zelebrieren alles "Kaputten" inhaltlich und formal ins Werk setzt und so den Balanceakt zwischen der Psychologie des Helden und der "übergeordneten Poetik" seines Romans meistert. Dabei weist Hartwig darauf hin, dass es Geltinger nicht darum geht, erotische "Räume zu erobern", auch wenn er unerschrocken in einer "grandiosen Szene" Engels Erfahrungen mit dem Stricher Tiago in einer Wiener Schwulenbar ausleuchtet, wie sie applaudiert. Genauso wenig aber versuche der Autor, seinen Helden zu "heilen" und so ist dieser Roman laut der begeisterten Rezensentin ein sehr wahrhaftiges, aber eben auch ein sehr "trauriges Buch" geworden.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH