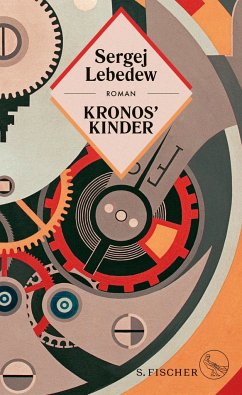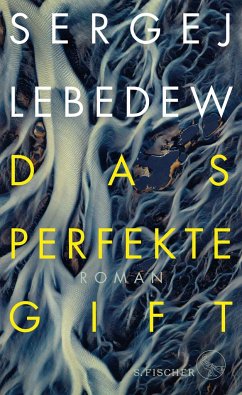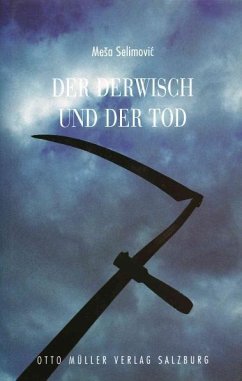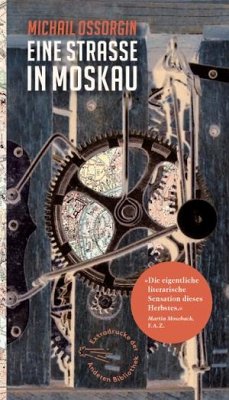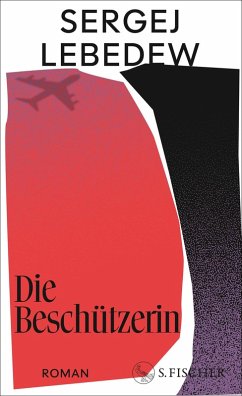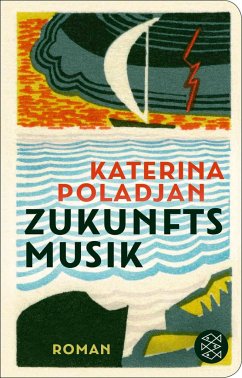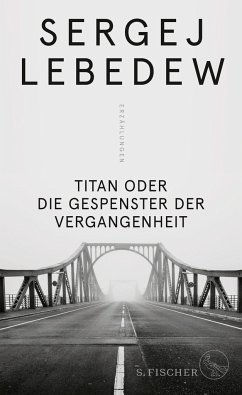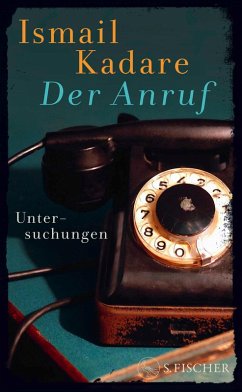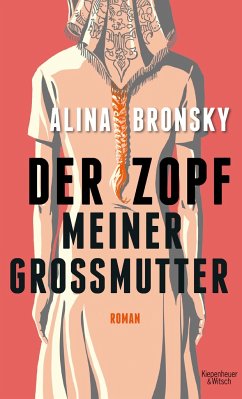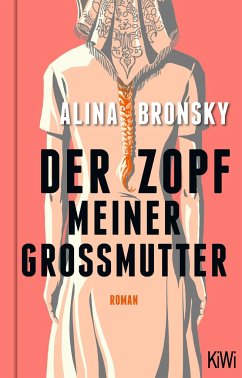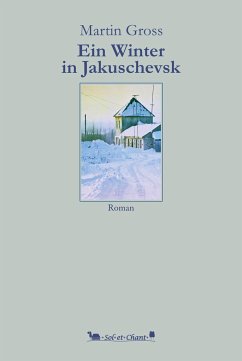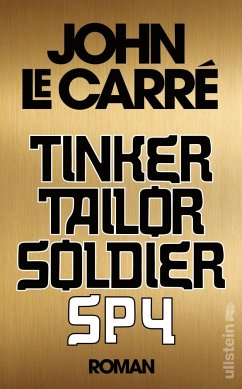Menschen im August
Versandkostenfrei!
Verlag / Hersteller kann z. Zt. nicht liefern
22,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:
Russland im August 1991: ein Putsch bringt das Land zum Beben, Gorbatschow wird abgesetzt, Jelzin übernimmt die Macht und Putin kann kaum erwarten, der Nächste zu sein. Das Land zerfällt. Nichts ist mehr, wie es Jahrzehnte lang war. Die einen verscherbeln Bodenschätze und Panzer und werden Multimillionäre, die anderen versinken in bitterer Armut. In dieser Zeit des totalen Umbruchs entdeckt der Ich-Erzähler das Tagebuch seiner Großmutter und erkennt, dass das Schweigen über die Vergangenheit gebrochen werden muss, wenn Russland eine Zukunft haben will. Ein hochaktueller, ein spannender...
Russland im August 1991: ein Putsch bringt das Land zum Beben, Gorbatschow wird abgesetzt, Jelzin übernimmt die Macht und Putin kann kaum erwarten, der Nächste zu sein. Das Land zerfällt. Nichts ist mehr, wie es Jahrzehnte lang war. Die einen verscherbeln Bodenschätze und Panzer und werden Multimillionäre, die anderen versinken in bitterer Armut. In dieser Zeit des totalen Umbruchs entdeckt der Ich-Erzähler das Tagebuch seiner Großmutter und erkennt, dass das Schweigen über die Vergangenheit gebrochen werden muss, wenn Russland eine Zukunft haben will. Ein hochaktueller, ein spannender Roman über ein Land, das schon lange keine Weltmacht mehr ist.





 buecher-magazin.deIm August 1991 fand in Moskau ein Putschversuch gegen Gorbatschow statt, der sich später als Auftakt zum Zerfall der Sowjetunion erwies. Wenn der 1981 geborene Sergej Lebedew sich im Titel seines neuen Romans auf diesen schicksalsträchtigen Monat bezieht, so evoziert er damit atmosphärisch das Bild eines Riesenlandes im Umbruch und Zerfall. Die konkreten politischen Ereignisse jener Jahre sind nur Rahmenhandlung. Das Romangeschehen ist an den geografischen Rändern des zerfallenden Sowjetreichs angesiedelt. Der Ich-Erzähler ist unablässig auf Reisen; angefangen mit einer privaten Mission, die ihn ins ukrainische Drohobytsch führt, wo er nach Spuren seines unbekannten Großvaters sucht. Fast schicksalhaft fallen ihm daraufhin andere Rechercheaufträge zu, diffizile Missionen, die ihn in die kasachische Wüste, in die karelische Taiga, ins sibirische Eis führen. Auch eine junge Frau, die er kennenlernt und die seine Geliebte wird, ist eine Suchende - die uneheliche Tochter eines verschollenen tschetschenischen Funktionärs. Für die Orientierungslosigkeit eines ganzen Landes findet Lebedew mit der Geschichte des jungen Mannes, der das Schicksal der verlorenen Toten ergründet, ein prägnantes Bild.
buecher-magazin.deIm August 1991 fand in Moskau ein Putschversuch gegen Gorbatschow statt, der sich später als Auftakt zum Zerfall der Sowjetunion erwies. Wenn der 1981 geborene Sergej Lebedew sich im Titel seines neuen Romans auf diesen schicksalsträchtigen Monat bezieht, so evoziert er damit atmosphärisch das Bild eines Riesenlandes im Umbruch und Zerfall. Die konkreten politischen Ereignisse jener Jahre sind nur Rahmenhandlung. Das Romangeschehen ist an den geografischen Rändern des zerfallenden Sowjetreichs angesiedelt. Der Ich-Erzähler ist unablässig auf Reisen; angefangen mit einer privaten Mission, die ihn ins ukrainische Drohobytsch führt, wo er nach Spuren seines unbekannten Großvaters sucht. Fast schicksalhaft fallen ihm daraufhin andere Rechercheaufträge zu, diffizile Missionen, die ihn in die kasachische Wüste, in die karelische Taiga, ins sibirische Eis führen. Auch eine junge Frau, die er kennenlernt und die seine Geliebte wird, ist eine Suchende - die uneheliche Tochter eines verschollenen tschetschenischen Funktionärs. Für die Orientierungslosigkeit eines ganzen Landes findet Lebedew mit der Geschichte des jungen Mannes, der das Schicksal der verlorenen Toten ergründet, ein prägnantes Bild.