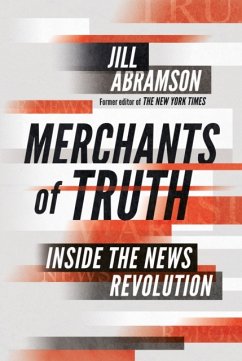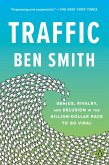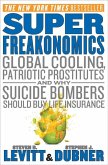Jill Abramson was the executive editor of The New York Times, the first woman to hold its most senior editorial position, between 2011 and 2014. During her seventeen years at the paper she was also the first woman to serve as its managing editor and as its Washington bureau chief. Before joining the Times, she spent nine years at the Wall Street Journal. She is now a senior lecturer at Harvard University and writes a bi-weekly column for the Guardian about US politics. She lives in New York City.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.