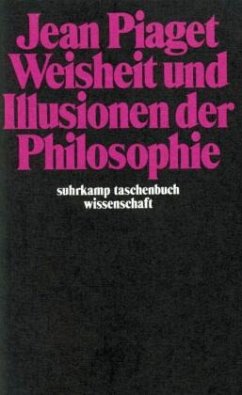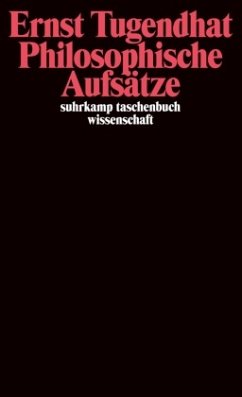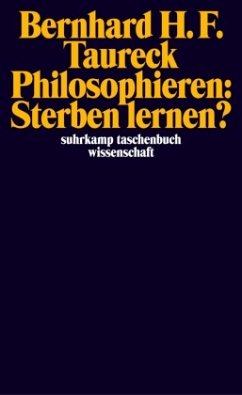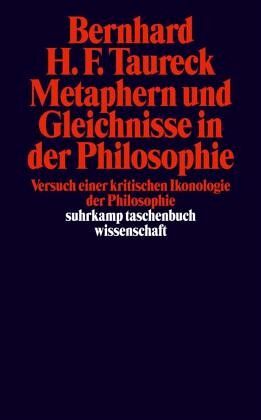
Metaphern und Gleichnisse in der Philosophie
Versuch einer kritischen Ikonologie der Philosophie
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
17,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Metaphern und Gleichnisse gelten seit Aristoteles als legitime Form der Mitteilung eigener Art, nämlich der Poesie. Daß Bilder auch in der Philosophie auftreten, war in der aristotelischen Metaphorologie nicht vorgesehen, jedoch auch nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Nun ist die europäische Philosophie von den Vorsokratikern bis Derrida nicht eben sparsam mit Gleichnissen und Metaphern umgegangen. Wird der philosophische Diskurs dadurch gestört oder befördert? Wie sind Metaphern und Gleichnisse in der Philosophie pragmatisch und semantisch zu beurteilen? Diese Fragen können nur im Rahm...
Metaphern und Gleichnisse gelten seit Aristoteles als legitime Form der Mitteilung eigener Art, nämlich der Poesie. Daß Bilder auch in der Philosophie auftreten, war in der aristotelischen Metaphorologie nicht vorgesehen, jedoch auch nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Nun ist die europäische Philosophie von den Vorsokratikern bis Derrida nicht eben sparsam mit Gleichnissen und Metaphern umgegangen. Wird der philosophische Diskurs dadurch gestört oder befördert? Wie sind Metaphern und Gleichnisse in der Philosophie pragmatisch und semantisch zu beurteilen? Diese Fragen können nur im Rahmen einer Philosophiegeschichte und Systematik verbindenden Konzeption gestellt und beantwortet werden. Trotz verschiedener Forschungen steht so etwas wie eine kritische Ikonologie der Philosophie noch aus. Die nun erscheinende Untersuchung will ein erster Versuch einer solchen Ikonologie sein.