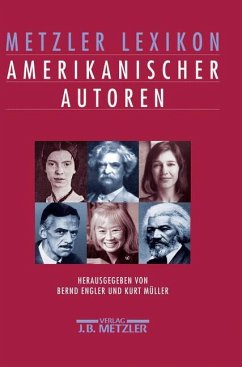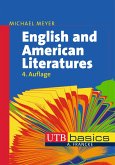Das Lexikon eröffnet in 350 Porträts repräsentativer US-amerikanischer Autorinnen und Autoren und ihrer Werke einen Überblick über die außergewöhnlich vielfältige Literatur der Vereinigten Staaten von der Kolonialzeit bis zur unmittelbaren Gegenwart. Es trägt dabei den sogenannten Klassikern, die den literarischen Kanon über viele Jahrzehnte dominierten, ebenso Rechnung wie den Repräsentanten von gesellschaftlichen Minoritäten und ethnischen Gruppen, die das kulturelle Bewusstsein Amerikas insbesondere seit Beginn des 20. Jahrhunderts durch innovative Impulse maßgeblich prägten. Insofern die amerikanische Literatur mit ihrer Vielzahl von politischen, didaktischen und religiösen Texten seit ihren Anfängen im 17. Jahrhundert mitunter auch Gebrauchsliteratur" war und somit die herkömmliche Unterscheidung von Werken der Hoch- und Populärkultur von vornherein problematisch ist, geht das Lexikon von einem "erweiterten" Literaturbegriff aus. Dementsprechend schließt es Autorinnen und Autoren von Detektivromanen und Science Fiction ebenso ein wie von so genuin amerikanischen Gattungen wie der slave narrative und der spirituellen Autobiographie. Mit ihrem Blick auf charakteristische, die spezifisch amerikanische Wirklichkeitserfahrung reflektierende Werke bieten die von ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verfassten Autorenporträts ein facettenreiches Panorama der literarischen Entwicklung der Vereinigten Staaten.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Alles identisch: Das "Metzler Lexikon amerikanischer Autoren"
Rund 340 Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind in diesem "Metzler Lexikon amerikanischer Autoren" versammelt. Die Auswahl erfolgte nach einem "erweiterten Literaturbegriff". Berücksichtigt wurden neben modernen Klassikern wie Hermann Melville, Theodore Dreiser oder Djuna Barnes auch Verfasser von Krimis und Science-fiction, von religiösen Traktaten und Gebrauchsliteratur, vor allem aber Textsorten ethnischer Minderheiten und feministisch orientierter Frauen. Die meisten Artikel sind gut lesbar; an den reinen Fakten gibt es wenig zu beanstanden.
Die Mitarbeiter an diesem Band hatten viel Freiheit und durften laut Vorwort ihren "je eigenen Stil" pflegen, der sich dann aber doch als ziemlich einheitlich herausstellt. Der Lexikonstil wurde insofern getroffen, als im ersten Satz der Beiträge mindestens ein Superlativ steht. Und so ist der gerade besprochene Autor immer auch die bedeutendste, wichtigste, produktivste, vielseitigste, unabhängigste, erfolgreichste, weltläufigste oder wenigstens intelligenteste Stimme seiner Zeit oder Umgebung.
Homogenität also, was die Sprache, nicht aber, was den Inhalt angeht. Die Stories von Truman Capote werden nacherzählt, über die "zahlreichen Kurzgeschichten" von Paul Bowles kein weiteres Wort verloren. Von Nabokovs Romanen werden nur drei erwähnt: "Lolita", "Pnin" und "Pale Fire". Leben und Werk der Autoren wurden unterschiedlich gewichtet. Der Eintrag über Patricia Highsmith ist mehr Vita denn Werkschau. Umgekehrt finden sich zu Paul Auster nur spärliche, zu Mark Twain keinerlei biographische Angaben. Ausführlicher werden weniger berühmte Schriftsteller gewürdigt, und so wissen wir jetzt, daß eine gewisse Nikki Giovanni eine "willensstarke Großmutter" hatte, daß Nella Larson bereits 1920 "ihren ersten Beitrag für die Kinderzeitschrift ,The BrowniesBook'" geschrieben hat und daß ein anderer Quondam nach seinem B.A.-Examen "ein Jahr am Bard College in Annandale-on-Hudson, nordöstlich von New York" unterrichtete (allerdings ohne Entfernungsangabe).
Demgegenüber bleibt unerwähnt, daß Ernest Hemingway einen großen Teil seines Lebens auf Kuba verbracht hat. Über seine Frauen: nichts. Nichts über seinen Alkoholismus, statt dessen wird er als "Liebhaber leiblicher Genüsse" hingestellt. Das Schicksal, als Vorläufer der Postmoderne eingestuft zu werden, teilt er mit Poe, Melville, Nabokov, John Barth und Richard Ford. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das sollten sich auch diejenigen sagen, die den Minimalisten zugeschlagen worden sind: neben Raymond Carver auch Robert Creeley, Bret Easton Ellis, wiederum Richard Ford und ein Dagobert Gilb.
Herausgeber und Verlag übten sich in politischem Gehorsam. Zwei Drittel der Beiträger kommen aus dem Umfeld der "Deutschen Gesellschaft für Amerikastudien". Den Umschlag zieren sechs Porträts, drei Frauen und drei Männer, einer davon schwarz. Der ethnischen und der weiblichen Selbstvergewisserung Raum zu geben ist eine gute Sache. Grob geschätzt geht es in jedem zweiten Beitrag um Identität, um die Suche nach Identität, den Verlust von Identität, um rassische, weibliche, ästhetische, nationale Identität, um kulturelle Identität sowieso. In dem Beitrag über den asiatisch-amerikanischen Dramatiker David Henry Hwang kommt der Identitätsbegriff fünfmal zum Einsatz.
Kompliziert wird es bei den hybriden Identitäten. Wer sich Erik Erikson zum Trotz auf eine "multiple Identität" einläßt, landet schnell und ohne unser Mitleid zu haben bei "komplexen multikulturellen indianisch-weiß-mexikanisch-asiatisch-schwarzen Identitäten (in unterschiedlichen Mischformen)". Über eine von Identitätszweifeln geplagte afroamerikanische Romanschriftstellerin heißt es: "Letztendlich fühlte sie sich weder in Kopenhagen noch in Harlem zu Hause." Das ist zwar traurig, aber, ehrlich gesagt, gleich.
Dieses Nachschlagewerk aus dem Hause Metzler mag politisch ausgewogen sein, die literaturgeschichtlichen Proportionen sind es nicht. Der Beitrag über Sam Shepard ist so lang wie die Beiträge über Ezra Pound oder Walt Whitman. Literarische Leichtgewichte wie Carlos Bulosan, Octavia E. Butler oder Terry McMillan erhielten mehr Platz als John Berryman, William Burroughs oder Edgar Lee Masters. Je eine Seite über Kate Chopin, Bret Harte und Oliver Wendell Holmes Sr., das Doppelte für die Science-fiction-Autorin Marion Zimmer Bradley, den Kriminalschriftsteller Tony Hillerman oder die Erzählerin Sandra Cisneros. Der Artikel über Louise Erdrich ist länger als der über Robert Lowell. Für Henry Miller blieben anderthalb, in herablassendem Ton gehaltene Seiten mehr als für x-beliebige Gelegenheitsdichter oder Selbstverlagslyriker.
Fast unglaublich, hätte Karl Valentin gesagt, ist die Zahl der Autoren und Autorinnen, die in diesem sogenannten Lexikon nicht enthalten sind. Es fehlen große Namen wie Maxwell Anderson, Louis Bromfield, Edgar Rice Burroughs, James Cabell, James Ellroy, Edna Ferber, Chester Himes, James Jones, J. P. Marquand, Mary McCarthy, James Michener, Edna St. Vincent Millay, Dorothy Parker, James Whitcomb Riley, Ole Rölvaag, William Saroyan, Booth Tarkington, Sara Teasdale, Gore Vidal oder Herman Wouk. Aus den Weggelassenen könnte man ein neues Buch machen.
Unterbelichtet ist der proletarische Roman; Albert Maltz fiel unter den Tisch. Bis auf Mark Twain fanden Amerikas große Humoristen keine Aufnahme: Finley Peter Dunne, Josh Billings, Artemus Ward, E. B. White. Bobbie Ann Mason muß allein den Vietnamkriegsroman repräsentieren, niemand kümmerte sich um Larry Heineman, Philip Caputo, Tim O'Brien oder Robert Stone. Alles in allem liegt vor uns nicht ein Lexikon, sondern eine Essaysammlung in alphabetischer Reihenfolge. Wohl wurde der Kanon erneuert: Er klingt jetzt vielstimmiger, doch es fehlen zu viele Noten. Die Enthierarchisierung der Literaturgeschichte darf nicht bedeuten, große Schriftsteller mit einem Ablaufdatum zu versehen und aus dem Verkehr zu ziehen.
GERT RAEITHEL
"Metzler Lexikon amerikanischer Autoren". Hrsg. von Bernd Engler und Kurt Müller. Verlag C. J. Metzler, Stuttgart 2000. VI, 768 S., 333 Abb., geb., 68,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Ein glatter Verriss! Zwar findet Rezensent Gert Raeithel die einzelnen Artikel in diesem Literaturlexikon gut geschrieben und faktisch korrekt. Aber, hebt der Rezensent zur Kritik an, mehr Positives gebe es auch nicht mehr zu melden. Die Sprache der Mitarbeiter an diesem Lexikon sei zwar recht vergleichbar, dafür aber der Inhalt umso weniger. Jeder Beitrag habe seine eigenen Schwerpunkte auf Autor und Werke gelegt, so dass viel Wichtiges fehle und viel Unwichtiges erwähnt werde, klagt Raeithel. Zwar habe sich der Metzler-Verlag bemüht, politisch korrekt Frauen wie Männer, Schwarze wie Weiße zu berücksichtigen, aber dafür die literaturgeschichtlich richtigen Proportionen vernachlässigt. Für die Autoren, die hier nicht berücksichtigt würden, könnte man glatt einen neuen Band herausgeben, stichelt der Rezensent, für den das Lexikon denn auch kein Lexikon, sondern vielmehr eine "Essaysammlung in alphabetischer Reihenfolge" ist.
© Perlentaucher Medien GmbH"
© Perlentaucher Medien GmbH"