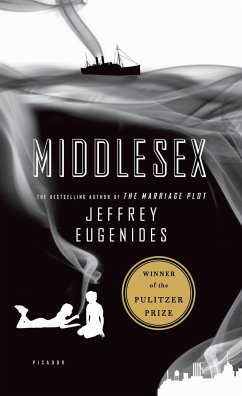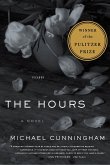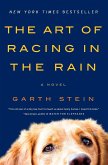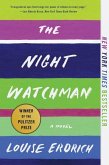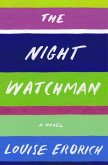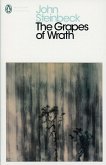Vom heutigen Detroit zurück ins Osmanische Reich verfolgt Cal eine seltene genetische Mutation und entdeckt dabei eine Familiengeschichte, die ihr eigenes Leben unerwartet in eine Odyssee verwandelt.
Sprawling across eight decades - and one unusually awkward adolescence - Jeffrey Eugenides´ long-awaited novel is an utterly original fable of crossed bloodlines, the intricacies of gender, and the untidy prompting of desire.
Sprawling across eight decades - and one unusually awkward adolescence - Jeffrey Eugenides´ long-awaited novel is an utterly original fable of crossed bloodlines, the intricacies of gender, and the untidy prompting of desire.

Kein kleiner Unterschied: Jeffrey Eugenides' Roman "Middlesex"
Middlesex" der mit viel Spannung erwartete zweite Roman des in Berlin lebenden amerikanischen Schriftstellers Jeffrey Eugenides, erzählt von einem Mädchen, das wie die Muse des Erzählens Calliope heißt, im Schülertheater den blinden Seher Teiresias spielt, später als Gott Hermaphroditos seinen zweigeschlechtlichen Unterleib gegen Geld vorführt und schließlich als männlicher Erzähler namens Cal seine Gene dafür verantwortlich macht, daß er "manchmal ein wenig homerisch" klingt. Ein bißchen viel Antike, könnte man meinen.
Aber das ist noch längst nicht alles. Das Schicksal einer griechischstämmigen Familei in der Türkei und das Massaker von Smyrna im Jahr 1922, die Auswanderung der Geschwister Stephanides über den Atlantik, die Autoindustrie von Ford bis Cadillac als Chiffre Amerikas, der Zweite Weltkrieg und Vietnam, Rassenunruhen und Black-Muslim-Bewegung, Watergate, die Hippiezeit und die beginnende Gender-Debatte - all dies wird auf 750 Seiten mal mehr, mal weniger ausführlich behandelt. Damit der Roman über der Fülle seiner Gegenstände nicht aus allen Nähten platzt und der Leser sich nicht schon nach zweihundert Seiten fühlt wie ein Reiter, der aus dem Sattel gehoben wurde und nun von einem durchgegangenen Gaul mitgeschleift wird, hat der Autor gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Zu ihrer Vorbereitung waren beinahe acht Jahre nötig, so lange hat Eugenides nach eigenem Bekunden an "Middlesex" gearbeitet. Die Mühe hat sich gelohnt.
Ein Roman, der die "Achterbahnfahrt eines Gens durch die Zeit" darstellen soll, wie auf der zweiten Seite angekündigt wird, zugleich die Geschichte einer griechischen Familie über mehrere Generationen schildert und die bewegende Suche eines Heranwachsenden nach seiner geschlechtlichen Identität beschreibt, bedarf vor allem einer belastbaren und glaubwürdigen Erzählperspektive. Eugenides wählt einen Ich-Erzähler, der bei Bedarf zum allwissenden Erzähler wird und durch Zeit und Raum zu reisen vermag, wie es ihm beliebt. Dank der "präfetalen Erzählperspektive", die den intimen Blick auch auf Ereignisse vor der eigenen Geburt erlaubt, ist es von Homer zu Calliope Stephanides nur ein Katzensprung.
Tatsächlich kokettieren der Autor und sein Held ganz gern mit ihrer griechischen Abstammung, aber die Verweise auf das Ursprungsland der klassischen Mythologie haben ihren tieferen Sinn. Nehmen wir nur die Episode im Schultheater. Als Callie, eine flachbrüstige Bohnenstange, das typische "Bügelbrett", wie der mitleidlose Fachausdruck jener Jahre lautete, die Rolle des Teiresias übernimmt, weiß sie nur, daß er der Seher von Theben war. Ein blinder, auf seinen Stock gestützter alter Mann im weiten Umhang - keine sehr attraktive Rolle für ein vierzehnjähriges Mädchen. Aber im Verlauf der Theaterproben lernt Callie von einer ihrer Mitspielerinnen, der koketten Darstellerin der Antigone, nicht nur, wie man einen Blinden spielt - nicht stolpernd und tastend, vielmehr still stehend, lauschend, mit den Ohren sehend -, sondern sie erfährt auch, daß sie wesentlich mehr mit Teiresias gemein hat, als sie sich hätte träumen lassen.
Wie hatte Teiresias eigentlich sein Augenlicht verloren? Ovid erzählt, daß Zeus und Hera, das Urbild aller zänkischen Ehepaare, in Streit darüber gerieten, welches Geschlecht in der Liebe mehr Vergnügen empfinde, Mann oder Frau. Als Schiedsrichter wurde der Nymphensohn Teiresias berufen, der als einziges Lebewesen aus eigener Erfahrung sprechen konnte: Als Mann geboren, wurde er für sieben Jahre in eine Frau verwandelt und kehrte dann in seinen Männerkörper zurück. Als Teiresias Zeus recht gab und sogar behauptete, das Vergnügen der Frau sei neunmal größer als das des Mannes, nahm ihm die erzürnte Hera das Augenlicht. Zeus, unfähig, die Tat der Gattin rückgängig zu machen, schenkte dem Geblendeten zum Trost die heikle Gabe der Prophetie und ein langes Leben.
Als Callie zum ersten Mal in ihrem Leben spürt, daß sie einen anderen Menschen begehrt, hält sie die kleine rothaarige Antigone in den Armen und trägt das Kostüm des Teiresias. Und wenn sie später Antigones Körper erforscht, im Ferienhaus, nachts, Callie mit der Konzentration eines Uhrmachers, die Geliebte schlafend und wach wie Kleists Marquise von O., erforscht sie zugleich den eigenen Körper, der ihr nicht weniger unbekannt ist. Eine Kettenreaktion beginnt, an deren Ende ein Unfallarzt enthüllt, was Callie ahnte, ohne es begreifen zu können: Sie ist keine Frau, die Frauen liebt, sondern ein Mann in einem Frauenkörper. So ungefähr jedenfalls. Der tatsächliche biologische Sachverhalt ist nämlich nicht nur für Callie und einen gewöhnlichen Ambulanzarzt, sondern auch für den Leser viel zu kompliziert, zumindest über die ersten paar hundert Seiten. Spätestens nach der Lektüre der Akte, die der New Yorker Sexologe Dr. Luce über Callie anlegt und die im Buch vollständig zitiert wird, gehen uns solche Fachbegriffe wie "5-alpha-Reduktase-Pseudohermaphrodit" geläufig über die Lippen. Die Augen geöffnet aber hat Calliope erst ihre Rolle als blinder Seher Teiresias. Er ist zugleich der Kronzeuge des zweigeschlechtlichen Erzählers dafür, daß sein Problem nicht ganz neu ist - nicht in der Welt und nicht in der Literatur.
Die Reise des Gens, das für Calliopes Zustand verantwortlich ist, nimmt ihren Ausgang neun Generationen vor ihrer Geburt, also vor rund 250 Jahren. Etwa zur gleichen Zeit, als in einem abgelegenen griechischen Dorf die Genmutation sich vermutlich als Folge von Inzest herausbildet, erhebt im weit entfernten England ein anderer Erzähler, nämlich Tristram Shandy, seinen Eltern gegenüber den Vorwurf, sie hätten sich bei seiner Zeugung "nicht gehörig vor Augen gestellt, wie viel von dem abhänge, was sie gerade taten". Shandy vertritt die Ansicht, daß die während der Zeugung herrschenden Launen und Stimmungen Einfluß auf das gesamte Leben des Kindes haben: "Ja ihr lieben Leute, glaubt mir nur, diese Sache ist nicht so unerheblich, als manche von euch glauben mögen."
Eugenides, der Nabokov und Tolstoi sowie Philip Roth und Saul Bellow zu den Autoren zählt, die ihn beeinflußt haben, verdankt manches in seinem Buch dem "Tristram Shandy" des Lawrence Sterne, einem erzählerischen Experiment, das zahlreiche Strukturelemente des modernen Romans vorwegnahm und als Vorläufer der Postmoderne gilt. Cal berichtet nicht nur wie Tristram detailliert über die eigene Zeugung und andere Ereignisse, die vor seiner Geburt stattfanden, sondern er orientiert sich auch an Sternes eigentümlichem Strukturprinzip, das zeitversetzte Erzählsequenzen ineinanderschachtelt.
Da ist zunächst das Berlin der Gegenwart, wo Cal als Angehöriger der amerikanischen Botschaft ein einsames Leben führt, das ihm Maßanzüge, teure Zigarren und handgenähte Schuhe nicht recht versüßen können. Während Cal die Geschichte seines Lebens und seiner Familie niederschreibt, also das Buch verfaßt, das wir lesen, entwickelt sich eine vorsichtige Liebesziehung zu einer asiatisch-amerikanischen Fotografin. Sie ist das vorerst letzte Glied einer Kette von fehlgeschlagenen Versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Cal nennt das die "Routine meiner unvollständigen Verführungen", denn bevor es Ernst wird, macht er sich regelmäßig aus dem Staub. Und so ist die pubertäre Episode mit der kleinen Antigone noch für den vierzigjährigen Kulturattaché die einzige sexuelle Erfahrung, die ihm glückliche Momente gewährte, auch wenn sie in einer Katastrophe endete. Cal verschweigt den Namen seiner großen Liebe und nennt sie nach Buñuels Filmklassiker nur "das obskure Objekt".
Die Romanze zwischen der fohlenhaften Callie, die verzweifelt darauf wartet, daß ihr Busen sich entwickelt und ihre Menstruation einsetzt, und statt dessen gegen aufkommenden Bartwuchs kämpfen muß, und der extrovertierten kleinen Diva mit roten Haaren gehört zu den bewegendsten Episoden dieses Buches, das ebenso viele anrührende wie komische Seiten hat. Dies gilt schon für die Familiengeschichte, die zweite Erzählebene, die in der Türkei beginnt, wo Desdemona und Eleutherios Stephanides Seidenraupen züchten, bis sie 1922 vor den Kriegshandlungen zwischen Türken und Griechen fliehen. Auf der Überfahrt findet eine folgenschwere Transformation statt: Als Bruder und Schwester verlassen Desdemona und Lefty die Heimat, als Mann und Frau kommen sie in der Neuen Welt an. Als ihr Sohn Milton auch noch seine Cousine Tessie heiratet, ist für das mutierte Gen die Stunde gekommen.
Calliope wird als Mann geboren, dessen primäre Geschlechtsorgane jedoch weiblich wirken. Das äußerst seltene Krankheitsbild, das Eugenides für seinen Erzähler ausgesucht hat, existiert tatsächlich und macht sich erst während der Pubertät bemerkbar. Deshalb wird Cal als Calliope erzogen, womit das alte Rätsel im Raum steht, was prägender wirkt: Vererbung und Biologie oder Erziehung und soziale Umwelt. Der Roman beleuchtet diese Frage aus vielen Winkeln, ohne sie zu entscheiden.
Als Callies Leidensgeschichte sich zuträgt, in den frühen siebziger Jahren, galt auch die sexuelle Identität als stark milieubedingt, der Unterschied zwischen Mann und Frau als Frage der Sozialisation. Jetzt schlägt das Pendel zurück in die biologische Richtung, und den Genen wird schicksalhafte Macht zugeschrieben. Cal konstatiert einmal, daß vermutlich keine andere Zeit ihm so günstige Rahmenbedingungen geboten hätte wie die bis zur völligen Orientierungslosigkeit liberalen Siebziger. Aber Callies Eltern stammten aus einem anderen Jahrzehnt.
Wie in "Die Korrekturen", dem Roman seines Freundes und Altersgenossen Jonathan Franzen, überstehen auch in "Middlesex" die Familienbande am Ende alle Wirren, nur die Väter müssen dran glauben. Wie zuvor der Eisenbahningenieur Alfred Lambert, der von Bord eines Ozeandampfers in die Tiefe fällt, lernt nun auch Milton Stephanides, Besitzer der Hercules-Hotdog-Kette am Ende seines Lebens das Fliegen. Er segelt nach einer wilden Verfolgungsjagd mit seinem Schwager in seinem Cadillac von einer Brücke. Dies ist nur ein skurriles Detail dieses witzigen, berührenden und lebensklugen Buches - und nur eine von vielen Parallelen zu Franzens Roman. Denn was ist etwa Dr. Luces' Vorschlag, Callie zu operieren, anderes als der Versuch einer chirurgischen Korrektur an einer Laune der Natur?
Gegen Ende eines Gesprächs, das Eugenides und sein Freund und früherer Student Jonathan Safran Foer für ein amerikanisches Magazin miteinander geführt haben, macht Eugenides ein - deutlich ironisch gefärbtes - Geständnis. "Calliope Stephanides, der vierzehnjährige männliche Pseudohermaphrodit, Schülerin einer Mädchenschule - c'est moi." Und tatsächlich: Das ist so wahr und so falsch wie Flauberts Behauptung, er sei Emma Bovary.
Jeffrey Eugenides: "Midlesex". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Eike Schönfeld. Rowohlt Verlag, Reinbek 2003. 735 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main