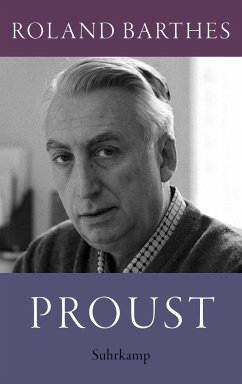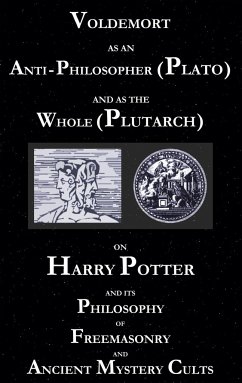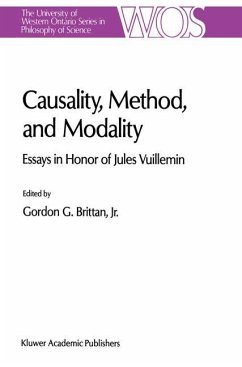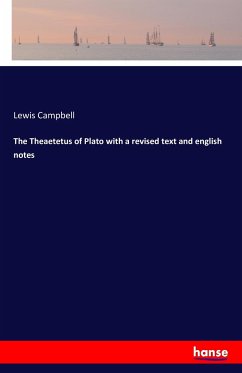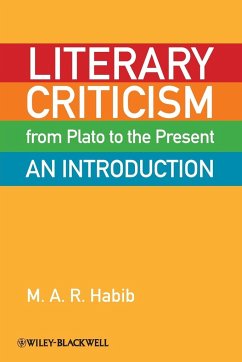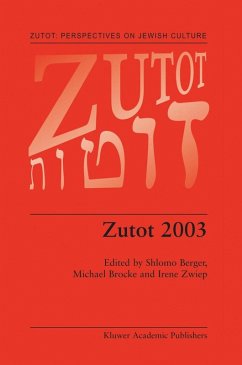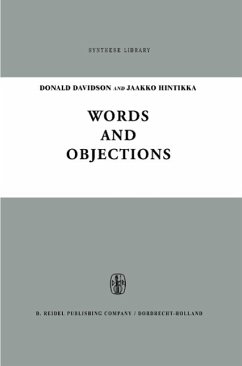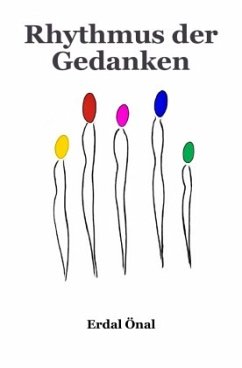Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar




Mimologiken
Produktdetails
- Verlag: Brill Fink / Brill Fink
- Artikelnr. des Verlages: 1882619
- Seitenzahl: 515
- Deutsch
- Abmessung: 215mm
- Gewicht: 610g
- ISBN-13: 9783770530731
- ISBN-10: 377053073X
- Artikelnr.: 27145629
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Dieses Buch von Gérard Genette beschäftigt sich mit der nach Meinung der Rezensenten mit dem Kürzel lx ziemlich wesentlichen Frage, ob Namen und Bezeichnungen von Dingen quasi naturgegeben sind oder unter den Sprechern, die über diese Dingen reden, ausgehandelt werden. Was bei dieser "anspruchsreichen wie originellen" Untersuchung herausgekommen ist, gefällt dem Rezensenten - nicht zuletzt, weil Genette den Bogen der Untersuchung weit spannt, von "mittelalterliche Sprachphilosophie bis zur Entdeckung der Hieroglyphen und zur modernen Linguistik".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für