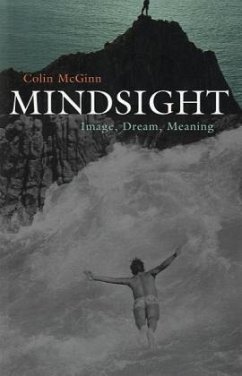Produktdetails
- Verlag: Harvard University Press
- Seitenzahl: 209
- Englisch
- Gewicht: 420g
- ISBN-13: 9780674015609
- Artikelnr.: 14083616

Colin McGinn entdeckt die autonome Welt der Vorstellungen
Ein neuer Geist geht um in der Philosophie, der Geist selbst nämlich. Neben dem in die Jahre gekommenen linguistic turn hat sich ein mentalistic turn vollzogen, von dem man sich Einsichten in unser Ego verspricht. Die Scheu vor dem vagen und vernutzten deutschen Wort „Geist” wie auch dem englischen „mind” ist einem resoluten Umgang mit diesen Vokabeln gewichen, die mit nicht weniger prekären Begriffen wie „Bewusstsein”, „Intentionalität” oder „Referenz” aufgeladen wurden. Wie die sprachliche Wende ist auch die Hinwendung zum Geist von analytischen Philosophen eingeläutet worden, nachdrücklich von John R. Searle mit seinem 1992 erschienenen Buch „Die Wiederentdeckung des Geistes”. Und wiederentdeckt hat jetzt Colin McGinn eine der bis dahin unterbelichteten Komponenten des Geistes, nämlich die Vorstellung oder die Fähigkeit des Sich-Vorstellens. Vorstellungen, so sein Fazit, sind der allgegenwärtige und zentrale Wesenszug des geistigen Lebens und „die größte evolutionäre Entdeckung seit den Warmblütern.”
McGinn, an der Rutgers University in New Jersey lehrend, ist der gegenwärtig wohl eigenwilligste und ideenreichste Philosoph aus dem englischen Sprachbereich. Er hat Entscheidendes zur Philosophie des Geistes und Ernüchterndes über die Grenzen philosophischen Suchens geschrieben. Mit seinen eindringlichen Analysen über die Rolle der Vorstellungen wagt er sich auf ein Terrain, dem die Philosophen, namentlich die analytischen, bisher nicht viel abzugewinnen vermochten.
Dass Vorstellungen zumeist als Derivate gelten, als blasse Kopien eines Originals, führt McGinn an der These David Humes vor. Danach sind Vorstellungen, die Hume „ideas” nennt, von Wahrnehmungen, die er als „impressions” bezeichnet, nur graduell unterschieden; auch Vorstellungen sind Wahrnehmungen, nur schwächere, weniger „lebendige”. McGinn widerlegt diese Auffassung Humes mit schlagenden Argumenten und entwickelt zugleich seine eigene Theorie, nach der Vorstellungen (images) radikal von (sinnlichen) Wahrnehmungen (perceptions) abgetrennt und als eine geistige Aktivität sui generis, als eine dritte Kategorie neben Wahrnehmen und Denken aufgedeckt werden.
Zu den Differenzen, die McGinn herauspräpariert, gehört an erster Stelle, dass Vorstellen, geistiges Sich-Vergegenwärtigen, ein Tun, eine Handlung ist. Vorstellungen unterliegen mithin dem Willen, ganz anders als Wahrnehmungen, die passiv hingenommen werden. Damit hängt zusammen, dass das Vorstellungsobjekt Aufmerksamkeit beansprucht, damit es überhaupt da ist und aufrechterhalten bleibt; während das Wahrnehmungsobjekt - der Baum vor dem Fenster - auch ohne Aufmerksamkeit auf das Gesichtsfeld einwirkt. Das Vorstellungsbild ist durch den Akt der Aufmerksamkeit geschaffen, Wahrnehmung dagegen ist durch äußere Reize stimuliert. Dazu paßt, dass Vorstellungsobjekte schlicht gegeben sind, nicht erschlossen werden. Man weiß, dass dies die Vorstellung von X ist, weil man wollte, dass sie es ist.
Ferner sind Vorstellungen im Unterschied zu Wahrnehmungen nicht informativ, denn sie enthalten nur das, was in sie hineingegeben wurde. Das macht sie, wie McGinn sagt, neutral gegenüber der Realität, wie auch gegenüber den durch die Physiologie der Augen gesetzten Begrenzungen des Räumlichen. Das Vorstellungsbild X gibt uns keinen Anhaltspunkt über seinen Standort, und es gibt darin auch keinen Unterschied zwischen Zentrum und Peripherie. Das gesamte Vorstellungsbild ist Zentrum. Diese Neutralität oder auch Offenheit begünstigt die Ausflüge des Vorstellens ins Reich des Möglichen.
Auch die Annahme, aufgrund gewisser Ähnlichkeiten zwischen Vorstellungen und Gedanken ließen sich Vorstellungen auf Gedanken oder Begriffe reduzieren, weist McGinn zurück - dabei Thesen Wittgensteins und Sartres aufgreifend, beide indes „raffinierend”. X sehen hält nicht davon ab, an Y zu denken; aber sich X vorstellen und zugleich an Y denken schließt sich aus. Man kann keine Vorstellung von einem roten Würfel bilden, während man ihn sieht, wohl aber den Begriff roter Würfel auf den roten Würfel anwenden, den man sieht. Der Begriff kann mit dem Wahrgenommenen verknüpft werden, nicht aber die Vorstellung. Kurz, die Souveränität der Vorstellungen gegenüber Wahrnehmungen wie Gedanken hält McGinn für erwiesen.
Im Folgenden wird die Vorstellungstheorie auf die Probe gestellt, vertieft und entfaltet. Die Aussicht, die der Geist bietet (mindsight) sowie der Ausdruck vom inneren oder geistigen Auge fungieren dabei keineswegs als bloße Metaphern, denn vorstellendes Sehen kann durchaus externe physikalische Dinge zum Inhalt haben. Klar wird ferner, dass sinnliche Wahrnehmungen uns narren können, unsere Vorstellungen hingegen nicht, eben weil sie willentlich erzeugt sind. Aus dem selben Grund haben Halluzinationen oder Illusionen nichts mit Vorstellungen zu tun; sie sind schlicht Fehlfunktionen des visuellen Systems.
In einem langen Kapitel konfrontiert McGinn sein Vorstellungskonzept mit dem Phänomen der Träume, in mancher Hinsicht vielleicht das problematischste, stellenweise auch kurioseste Kapitel des Buches, wenn etwa Vermutungen angestellt werden, ob Träume nur „schwarz/weiß” sein können. Problematisch wird es, wenn Träume der Vorstellungstheorie assoziiert werden sollen. Vorstellungen werden ja, wie man sah, willentlich gebildet, Träume dagegen widerfahren dem passiven Schläfer. Hier sucht sich McGinn mit einer Konstruktion zu helfen, die allzu spekulativ erscheint. Er teilt die Traumbühne in Autor und Zuschauer, der Autor wirkt hinter der Aufmerksamkeit des Publikums. Das, so McGinn, erzeuge die Illusion psychologischer Passivität. Traumbilder seien das Produkt eines unbewussten Willens und folglich intelligentes Design, nicht bloß krude Abfolge von Bildern. Aber was ist ein unbewusster Wille? Und wer soll der hinter der Szene agierende Autor sein?
Träumer seien ferner extrem leichtgläubig, überzeugt von dem, was sie träumen, während Vorstellungen keine Überzeugungen erfordern; niemand glaubt, in Paris zu sein, bloß weil er es sich vorstellt. Aber Träume bestehen doch aus Vorstellungen, hieß es. Auch zu diesem Widerspruch hat McGinn einfallsreiche Analogien zu Filmen und Romanlektüren zur Hand, die freilich nicht alle Bedenken zerstreuen.
Bisher war ausschließlich von sinnlich-bildlichem Vorstellen die Rede, etwa in der Form „X stellt sich Y vor”. McGinn sieht darin einen sublimen, höheren Typ von Vorstellungen, den er als „kognitives Vorstellen” bezeichnet, der Form „X stellt sich vor, dass p” (p etwa: „Fido knurrt leise”). Man kann sich vorstellen, dass im Nebenzimmer ein Tausendeck steht, aber ich kann mir kein Tausendeck vorstellen.
Das Nein der Imagination
Kognitives Vorstellen hat es also mit Gedanken und Begriffen, nicht mehr mit Sinnlichem zu tun. In diese knifflige Thematik hat McGinn eine ungemeine Klein-, Fein-, und Knochenarbeit investiert. Hingewiesen sei lediglich noch auf die Funktion, die McGinn dem Vorstellen bei der Negation zuweist. Verneinung, erklärt er, kommt nicht durch Wahrnehmung, sondern durch Vorstellung in unsere Gedanken. Man kann die Möglichkeit erwägen, dass Gras nicht grün ist. Die Rolle der Negation bei der Erzeugung des Nicht-Wirklichen ist eine Errungenschaft der Vorstellung. Davon überzeugt sein, dass p, heißt sich p vorstellen und zugleich auch nicht-p vorstellen. Vorstellungen sind also auch im logischen Denken präsent, dieses ist dem Vorstellen keineswegs entgegengesetzt, es nutzt das Vorstellen vielmehr aus.
Alles nur Spitzfindigkeiten scholastischer Lehnstuhlgelehrter? Nun, solche Subtilitäten sind grundlegende Themen theoretischer Philosophie. McGinn hat ans Licht gebracht, dass die allein unserer Spezies zukommende Kapazität des Vorstellens - oder nehmen wir hier einmal das im Deutschen so positiv klingende Wort „Imagination” - uns in die Lage versetzt, über die Welt des Faktischen hinaus ins Reich des Möglichen (und Unmöglichen) hinauszublicken. McGinn hätte hier etwa auf das Verfahren so genannter Gedankenexperimente verweisen können, in denen das Vorstellen seine wissenschaftliche Produktivität erweist. Aber er vermerkt selbst, dass er in diesem Buch die Rolle der Vorstellung in der Wissenschaft, der Philosophie selbst und vor allem der Kunst ausgespart hat. Das holt er hoffentlich bald nach, wobei er sich vielleicht mehr auf die europäische Tradition einlassen wird, in der, vornehmlich im deutschen Idealismus unter dem Stichwort „Einbildungskraft”, einiges Bemerkenswertes zu einer Theorie der Vorstellungen gespeichert ist.
WILLY HOCHKEPPEL
COLIN MCGINN: Mindsight. Image, Dream, Meaning. Harvard University Press. Cambridge, Mass. 2004. 209 Seiten, 22,34 Euro.
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH