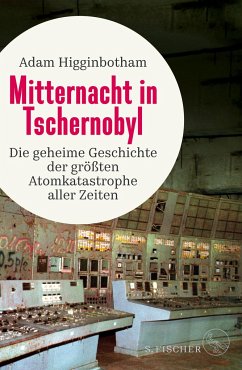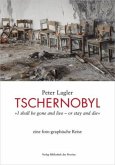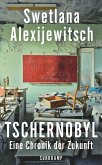In seinem Tschernobyl-Thriller deckt Adam Higginbotham auf, was wirklich geschah. Mit großer Erzählkunst und basierend auf intensiver Recherche zeichnet er nach, wie am frühen Morgen des 26. April 1986 der Reaktor 4 des Kernkraftwerks in Tschernobyl explodierte und die schlimmste Atomkatastrophe der Geschichte auslöste.
Seither gehört Tschernobyl zu den kollektiven Albträumen der Welt: eine gefährliche Technologie, die aus den Rudern läuft, die ökologische Zerbrechlichkeit und ein ebenso verlogener wie unachtsamer Staat, der nicht nur seine eigenen Bürger, sondern die gesamte Menschheit gefährdet.
Wie und warum es zu der Katastrophe kam, war lange unklar. Adam Higginbotham hat zahllose Interviews mit Augenzeugen geführt, Archive durchforstet, bislang nicht veröffentlichte Briefe und Dokumente gesichtet. So bringt er Licht in die Geschichte, die bislang im Sumpf von Propaganda, Geheimhaltung und Fehlinformationen verborgen lag. Erschütternd, packend: »Wie ein Thriller.« Luke Harding
Seither gehört Tschernobyl zu den kollektiven Albträumen der Welt: eine gefährliche Technologie, die aus den Rudern läuft, die ökologische Zerbrechlichkeit und ein ebenso verlogener wie unachtsamer Staat, der nicht nur seine eigenen Bürger, sondern die gesamte Menschheit gefährdet.
Wie und warum es zu der Katastrophe kam, war lange unklar. Adam Higginbotham hat zahllose Interviews mit Augenzeugen geführt, Archive durchforstet, bislang nicht veröffentlichte Briefe und Dokumente gesichtet. So bringt er Licht in die Geschichte, die bislang im Sumpf von Propaganda, Geheimhaltung und Fehlinformationen verborgen lag. Erschütternd, packend: »Wie ein Thriller.« Luke Harding

Vom Ende einer Zukunftstechnologie: Adam Higginbotham beschreibt die Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl im Sekundentakt.
Von Kerstin Holm
Nach der vielgelobten HBO-Minifernsehserie über die Reaktorkatastrophe im sowjetukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl gibt es nun eine veritable Tschernobyl-Enzyklopädie, die zugleich so fesselnd zu lesen ist wie ein Filmdrehbuch. Denn für seine monumentale Dokumentation "Mitternacht in Tschernobyl", die im Original die "unerzählte Geschichte der größten Atomkatastrophe" untertitelt ist, was die deutsche Ausgabe frei als "geheime Geschichte" übersetzt, hat der englische Journalist Adam Higginbotham nicht nur den Hergang des Unfalls im Sekundentakt rekonstruiert und die Erinnerungen der Beteiligten, vom Werksdirektor bis zum Feuerwehrmann, aufgezeichnet beziehungsweise, wo die betreffende Person verstorben war, Freunde befragt; Higginbotham erzählt nebenher die Geschichte der Nutzbarmachung der Kernkraft von ihren militärischen Anfängen im Zweiten Weltkrieg bis zu den Debatten nach Fukushima und im Angesicht der Klimakrise.
Higginbotham lässt aber auch anhand von erst unlängst freigegebenen Archivakten das Drama der späten Sowjetunion nacherleben mit ihrem fast religiösen Wissenschaftsglauben einerseits und der Geheimhaltungsmanie andererseits, die, gepaart mit planwirtschaftlicher Schlamperei, die Katastrophe herbeiführten. Mit Exkursen in die Familiengeschichte seiner Helden und ihren Erinnerungen entwirft er obendrein eine Art Krieg-und-Frieden-Panorama der sowjetischen Kerntechnologie, deren Desaster eine Opferbereitschaft mobilisierte, die im Westen für Erstaunen sorgte. Dass bei der Fülle des Materials, die der Autor für sein Buch aufbietet - in manchen Textpassagen führt jeder Satz einige Anmerkungen mit sich - , ein paar Flüchtigkeitsfehler stehengeblieben sind, schmälert die Verdienste des Autors überhaupt nicht.
In der Sowjetunion, die sich als Herausforderin des kapitalistischen Westens definierte und die schon 1954 den ersten zivil genutzten Nuklearreaktor baute - zwei Jahre vor den Vereinigten Staaten -, galt Vorsicht oftmals als kleinkariert. Dass der Unglücksreaktor bei der mittelalterlichen Stadt Tschernobyl - zu Deutsch "Wermut" - errichtet und nach ihr benannt wurde, nimmt sich da aus der Rückschau wie ein Omen aus. Higginbotham schildert die halb tollkühne, halb ignorante Verachtung, die viele Mitarbeiter des Kernkraftwerks der latenten Strahlengefahr entgegenbrachten. Als Betreuer einer Zukunftstechnologie und Bewohner des privilegierten Musterstädtchens Pripjat ließen sie sich vom Fortschrittsoptimismus der Moskauer Kernphysik-"Götter" gern anstecken. Gefördert wurde dies auch dadurch, dass die Staatsführung nicht nur die Explosion im Atomkraftwerk bei Tscheljabinsk 1957 verheimlichte, die große Gebiete verseuchte, sondern sogar den Reaktorunfall im amerikanischen Harrisburg 1979 medial ignorieren ließ, um die Aufbruchsstimmung der einheimischen Atomindustrie nicht zu dämpfen. Die Kombination aus oft mangelhaften Bauteilen, Übergröße, versäumten Sicherheitstests sowie dem Bemühen, um der Prämien willen Planziffern überzuerfüllen, machte zumal aus dem Tschernobyl-Reaktor ein nur mit großem Aufwand zu manövrierendes Monstrum.
Entscheidend für die Katastrophe vom 26. April 1986 war, dass bei dem unausgereiften Reaktortyp von Tschernobyl der sogenannte positive Dampfblasenkoeffizient ins Spiel kam: Er beschreibt, dass das Kühlmittel Hohlräume erzeugen und kurzfristig verdampfen kann, wodurch sich die Reaktivität plötzlich erhöht. Wissenschaftler hatten vor dem Baufehler gewarnt. Dennoch wurde das Modell sogleich in Serie gebaut, ohne dass seine Konstrukteure klärende Warnhinweise für die Bedienung formuliert hätten. Ein Problem war auch, dass die Steuerstäbe, mit welchen die Kettenreaktion moderiert wurden, nicht nur Borcarbid enthielten, welches die Neutronen absorbiert, sondern, da wirtschaftlicher gearbeitet und "Neutronen gespart" werden sollten, auch mit kleinen Graphitspitzen versehen waren, welche die Spaltung wiederum erleichterten. Beim Herunterfahren stieg daher die Reaktorleistung zunächst kurzfristig an. Higginbotham spricht von einer absurden, unheimlichen Umkehrung eines Sicherheitsmechanismus. Von den Operatoren war deshalb ein hohes Maß an Erfahrung und mechanischer "Intuition" gefordert.
Doch als in jener Frühlingsnacht der wegen Plansollvorgaben immer wieder verschobene Test der Notstromversorgung endlich stattfand, war der Physiker aus der Sicherheitsabteilung, der ihn überwachen sollte, nicht erschienen, so dass ein junger Nachwuchsingenieur die Bedienung übernahm. Higginbotham entwirft ein kinotaugliches menschliches und technologisches Drama. Als der junge Ingenieur merkte, dass er die Kontrolle über den Reaktor verlor, wollte er den Test abbrechen, fügte sich dann jedoch panisch dem Befehl des Chefingenieurs, ihn doch durchzuziehen. Der Erzähler beschreibt das dumpfe Geheul, das die Selbstzerstörung des Reaktors begleitet, erklärt anschaulich und genau, wie die Innentemperatur bei der Kernschmelze fast die der Sonnenoberfläche erreicht, bevor die tonnenschwere Schutzhülle wie Spielzeug zerspringt, Uran und radioaktives Graphit hinausgeschleudert und gasförmige Radioisotope in die Atmosphäre emporgesogen werden. Der radioaktive Niederschlag fiel auch deshalb so verheerend aus, weil eine Sicherheitskuppel über dem Reaktor eingespart worden war.
Die Sowjetführung hielt die Katastrophe fast drei Tage lang geheim, erst als radioaktiver Niederschlag in Schweden gemessen wurde, rang sie sich zu einer knappen Meldung über die Havarie durch. Zu der Zeit hatten schon etliche Feuerwehrleute und Praktikanten, die ohne Strahlenschutz, ohne Dosimeter und mit halbkaputtem Gerät den Reaktorbrand zu löschen versuchten, tödliche Dosen abbekommen. Die sozialistische Musterstadt Pripjat, der die Staatssicherheit zunächst die Telefonleitungen gekappt hatte, war mit einem Großaufgebot von Bussen evakuiert worden - für zwei, drei Tage, wie man den zumeist ahnungslosen Menschen versicherte.
Doch die eigentliche "Schlacht", das Bombardement der brennenden Ruine aus der Luft mit Sand, Ton, Blei und Dolomit, das aber, da der Reaktorkern sich fast ganz verzehrte, weitgehend nutzlos war, begann erst. Sowjetische Physiker fürchteten obendrein ernsthaft, dass sich bei einer Kernschmelze atomare Lava tief in die Erde hineinfressen könnte. In mehreren heroischen Einsätzen pumpten daher Militärtechniker das radioaktive Wasser aus dem Reaktorkeller und hoben darunter bei glühender Hitze einen Kontrollraum aus.
Higginbothams Buch bildet das Chaos, den alles und alle überfordernden Horror jener Tagen und Wochen in dicht getakteten Szenen ab. Die Armeemaschinerie improvisierte. Da Räumapparate und Roboter infolge der Strahlung bald den Geist aufgaben, mussten "Bioroboter", sprich Soldaten, den radioaktiven Schutt beseitigen. Von den Liquidatoren arbeiteten viele aus Opfermut, einige wegen der versprochenen Zulagen, gelegentlich kam es jedoch auch zu Meuterei und Desertion.
Es ist dem Autor hoch anzurechnen, dass er die schuldig gewordenen Helden der sowjetischen Atomwirtschaft mit Einfühlungsvermögen porträtiert, sogar den unterqualifizierten Kraftwerksdirektor Viktor Brjuchanow, der noch tagelang wider eigenes besseres Wissen behauptete, der Unglücksreaktor sei intakt. Umso mehr erscheint der Kernphysiker Valeri Legassow, der bei der Unfallbekämpfung eine Schlüsselrolle spielte, im Sommer 1986 seinem bedrängten Land bei der Konferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation in Wien den Ruf rettete, danach aber von Kollegen geschnitten wurde und 1988 den Freitod wählte, als tragische Figur.
Die Tschernobyl-Katastrophe und vor allem auch der Umgang der Verantwortlichen mit ihr trugen entscheidend dazu bei, dass Michail Gorbatschow seine Glasnost-Politik durchsetzen konnte. Für Gorbatschow war Tschernobyl aber auch ein Grund dafür, dass sein Versuch, die Sowjetunion zu erhalten, scheiterte. Wie viele Menschenleben der Unfall kostete, weiß man nicht, auch weil Ärzte angehalten wurden, weniger akute und langfristige Gesundheitsschäden nicht als strahlenbedingt zu dokumentieren. Inzwischen scheinen sich in der verstrahlten Zone Flora und Fauna teilweise erholt zu haben, es leben wieder etwa tausend Landwirte dort, die Zahl der Tschernobyl-Touristen wächst. Trotz des Einbruchs des Vertrauens in die Kernkraft sind russische Atomreaktoren weiterhin in der Ukraine in Betrieb. Und wenn Higginbotham anmerkt, Atomkraft sei statistisch gesehen sicherer als alle anderen Formen der Energiegewinnung, erinnert das vor allem daran, dass Kontrolle nie lückenlos funktioniert.
Adam Higginbotham: "Mitternacht in Tschernobyl". Die geheime Geschichte der größten Atomkatastrophe aller Zeiten. Aus dem Englischen von I. Gabler. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2019. 640 S., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Man liest dieses meisterhafte Buch mit angehaltenem Atem. Alexander Kluy Der Standard 20200420