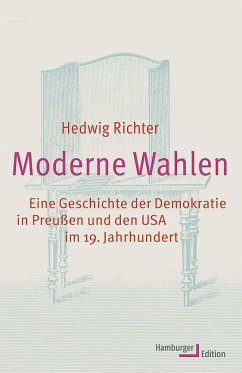Freie Wahlen sind ein essenzielles Element jeder Demokratie. Doch ihr Verhältnis zueinander und zum Volk als Hauptakteur war schon immer zwiespältig, wie ein Blick auf die Geschichte zeigt.
Über den Vergleich der Wahlpraxis in Preußen und den USA im 19. Jahrhundert rekonstruiert Hedwig Richter die Geschichte der Demokratie.
Die Autorin hinterfragt in ihrer umfassenden Historiografie des Wahlrechts die Erzählung vom großen Freiheitskampf des Volkes um die Einführung allgemeiner Wahlen und widerlegt die These vom anthropologischen Bedürfnis des Menschen nach politischer Verantwortung. Denn das Wahlrecht wurde häufig von oben eingeführt und als Disziplinierungsinstrument der Herrschenden genutzt.
Der Fokus auf den konkreten Akt des Wählens erlaubt zudem einen neuen Blick auf die alte Frage, warum im Laufe des 19. Jahrhundert zwar immer mehr Männer als »gleich« anerkannt wurden und das Wahlrecht erhielten, Frauen jedoch erst Jahrzehnte später.
Über den Vergleich der Wahlpraxis in Preußen und den USA im 19. Jahrhundert rekonstruiert Hedwig Richter die Geschichte der Demokratie.
Die Autorin hinterfragt in ihrer umfassenden Historiografie des Wahlrechts die Erzählung vom großen Freiheitskampf des Volkes um die Einführung allgemeiner Wahlen und widerlegt die These vom anthropologischen Bedürfnis des Menschen nach politischer Verantwortung. Denn das Wahlrecht wurde häufig von oben eingeführt und als Disziplinierungsinstrument der Herrschenden genutzt.
Der Fokus auf den konkreten Akt des Wählens erlaubt zudem einen neuen Blick auf die alte Frage, warum im Laufe des 19. Jahrhundert zwar immer mehr Männer als »gleich« anerkannt wurden und das Wahlrecht erhielten, Frauen jedoch erst Jahrzehnte später.

Die Anderen, das sind wir: Hedwig Richter über die Entwicklung der Demokratie in Deutschland.
Zum Eintritt in das neue Jahrhundert schrieb die "Vossische Zeitung" am 31. Dezember 1899: "Die Schätze, mit denen das 18. Jahrhundert prunkte, waren erlogene, erträumte. Die Güter der Aufklärung, der Menschenliebe und Duldung kamen einem Kreis von satten Menschen zugute. In welchem dumpfen Drucke, in welchem Mangel für Magen, Herz und Geist die ungeheure Menge ihr Dasein zubrachte, sah man nicht." Erst das nun endende, das neunzehnte, das "soziale Jahrhundert", habe "die Welt verändert".
Die "Vossische Zeitung" war ein bürgerlich-liberales Blatt, aber der sozialdemokratische "Vorwärts" sah es ähnlich. Es sei der "bleibende Ruhm" des neunzehnten Jahrhunderts, "die Massen selbst zu den entscheidenden Trägern der menschlichen Kultur" gemacht zu haben. Ludwig Windthorst, der führende Mann des katholischen Zentrums, hatte schon 1873 festgestellt, dass "es mit dem Beschränken des Wahlrechts nicht mehr geht". Und selbst der scharf monarchistisch empfindende Historiker Heinrich von Treitschke erkannte "ein historisches Gesetz der Demokratisierung".
Hedwig Richter, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München, hat ein Buch über die Entwicklung der Demokratie in Deutschland geschrieben, das diesen Enthusiasmus aufnimmt. Den Begriff der Demokratie fasst sie weit, es geht um Teilhabe, ein "Projekt von Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit", um Menschenwürde, kurzum: eine Geschichte der inneren Verfassung Deutschlands. Das ist ein reicher Stoff, viel Platz gönnt sich die Autorin nicht, und doch bleibt das Buch dank der geschickt ausgewählten Details und Zitate nicht in Thesen oder Merksätzen stecken.
Immer wieder kommt die Autorin auf einige Grundgedanken zurück, den etwa, dass die Demokratie eine Sache der Massen ist, aber auch der Eliten - und dies nicht unbedingt zum Schaden der Massen. Demokratie ist eine Sache der Grenzen und Einschränkungen, aber sie will international betrachtet werden, womit das alte Lied von der deutschen Knechtseligkeit viel von seiner Überzeugungskraft verliert. Und Demokratie ist eine Frage der Frauenrechte.
Richter setzt ein mit der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, mit der "ungeheuren", geradezu explodierenden Idee der Gleichheit und Menschenwürde: "All men are created equal", heißt es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Mit diesen Ideen korrespondiert das Ideal des mitleidigen Menschen. Mitleid wurde später oft skeptisch beurteilt, als eine Art von Herablassung; Bertolt Brecht dürfte in diesem Punkt auf seine deutschen Leser großen Einfluss gehabt haben, wie Richter sehr plausibel vermutet. Aber es steckt im Mitleid eine Empfindung elementarer Gleichheit: Das sind wir.
Damit entwickelte sich die Fähigkeit, über den engen Kreis von Familie und Nachbarschaft Anteilnahme zu entwickeln - und den Willen zur Abhilfe. Jetzt erst wird Armut nicht mehr als das natürliche Schicksal der Mehrheit gesehen, sondern als ein Skandal. Zugleich geht mit der Hochschätzung des Mitleids die Kritik von Krieg und Gewalt als typisch männlichen Neigungen einher und die Neubewertung der Frau als des "heilen, ganzen, mitfühlenden" Geschlechts. Sie werden als die Triebfedern im Fortschritt der Zivilisation begriffen.
"Jeder Landmann", schreibt Justus Möser 1775, "soll mit dem Gefühl seiner eigenen Würde auch einen hohen Grad von Patriotismus bekommen; jeder (...) sollte glauben, die öffentlichen Anstalten würden auch seinem Urteil vorgelegt." Doch solche republikanische Tugend muss wachsen. Als nach den Napoleonischen Kriegen in den preußischen Städten die Stadträte gewählt werden, ist das eine höchst würdige, aber auch umständliche Zeremonie, an der die weniger gutgestellten Bürger nur ungern teilnehmen.
Politische Teilhabe ist eine Elitenfreude, vor allem unter Beamten. Dem ärmeren Teil des Volkes ist das wirtschaftliche Hemd näher als der politische Rock. Das ist in Deutschland nicht anders als in Frankreich und den Vereinigten Staaten. Demokratie muss gelernt werden, es bedarf der "Weckung des Gemeinsinns" oder, straffer ausgedrückt mit Freiherr vom Stein, der "Nationalerziehung".
Was aber bringt die Eliten dazu, auf solche Erziehung zu setzen und damit langfristig ihren Einfluss mit den Vielen zu teilen? Das Ideal ist Selbstzügelung oder auch Selbststeigerung. In der Moderne bedarf der Staat des mitdenkenden Bürgers. Es ist ein anspruchsvolles Ideal, aber es bleibt nicht wirkungslos. In der Revolution von 1848 sind die Forderungen politischer Mitwirkung nicht mehr nur die der Oberschicht, auf dem Friedhof der Märzgefallenen in BerlinFriedrichshain liegen wenige Bürger, aber viele "Arbeitsmänner". Dass Demokratie den Bürgern etwas abverlangt, ist bald auch der Arbeiterbewegung selbstverständlich: "Der Endsieg des Proletariats" sei nicht nur der über den Kapitalismus, "sondern auch über sich selbst", meint der belgische Sozialdemokrat Émile Vandervelde.
Und als die Frauen 1919 zum ersten Mal wählen dürfen, beschreibt die Frauenrechtlerin Gertrud Bäumer das als eine Schwelle, die ihr Geschlecht überschreite, "nicht erfüllt von uns, sondern von allem, dem wir dienen". Zu dieser Zügelung der Demokratie gehört auch der Einfluss der Parteien, die die politische Willensbildung regulieren und der Kompromissbildung vorarbeiten.
Hedwig Richter unterschlägt nicht, dass die Demokratie ihre dunkle Seite hat. Die Erbitterung, mit der der Erste Weltkrieg ausgekämpft wurde, die Unfähigkeit, 1919 einen Frieden zu schließen, mit dem die Gegner leben konnten, die Ideen der Eugenik, sie haben ihrerseits demokratische Wurzeln. Aber es überwiegt in ihrem Buch ein Optimismus, der sich auch von den aktuellen Krisenerscheinungen nicht einschüchtern lässt. Dieser Optimismus macht sie zu einer Parteigängerin des Reformprinzips.
Wer beobachtet, dass Demokratie es mit Grenzziehung und Zähmung zu tun hat, wird dem revolutionären Prinzip gegenüber vorsichtig sein. Wer aus der Perspektive der Frauen die Barrikadenkämpfer studiert, erkennt, "wie intim die revolutionäre Ideenwelt mit männlicher Körperlichkeit verknüpft war" und dass eine Politik der Militanz Frauen wenig zu bieten hat. Und wer das bei Richter liest, der wird mit Vergnügen das Zusammenspiel der gedanklichen Motive verfolgen, auch dort, wo er womöglich zu anderen Schlüssen kommt.
STEPHAN SPEICHER
Hedwig Richter:
"Demokratie".
Eine deutsche Affäre.
Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
Verlag C. H. Beck,
München 2020.
400 S., Abb., geb., 26,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main