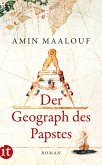Warum bekriegen sich seit jeher Menschen im Namen der Rasse, der Religion oder der Herkunft?
Amin Maalouf, in Frankreich lebender Essayist und preisgekrönter Romancier, geht dieser Frage auf historisch fundierte Weise auf den Grund. Ein engagiertes Plädoyer gegen Rassismus, Fundamentalismus und Segregation.
Amin Maalouf, in Frankreich lebender Essayist und preisgekrönter Romancier, geht dieser Frage auf historisch fundierte Weise auf den Grund. Ein engagiertes Plädoyer gegen Rassismus, Fundamentalismus und Segregation.

Auf dem Basar der Identitäten: Amin Maalouf verteidigt das osmanische Geistesmarktregiment
Das Nachdenken über Toleranz zeichnet sich dadurch aus, daß es erst am konkreten Fall seine übliche Langeweile verliert. So sollte man sich von der Allerweltsmetaphorik in den Anfangskapiteln dieses Buchs - die wie ein Trommelfell in alle Richtungen gespannte Identität einer Person, das nie bis unten endgültig vollgeschriebene Blatt einer (Leit-)Kultur, das diagonale, nie frontale Segeln gegen den "Wind der Globalisierung" - nicht entmutigen lassen und zügig weiterlesen, bis der Autor zu seiner eigenen Geschichte kommt. Sie ist spannend genug. Der im Libanon geborene, heute in Paris lebende Amin Maalouf, Verfasser einiger auch ins Deutsche übersetzter historischer Romane, ist arabischer Christ, genauer gesagt: er entstammt der melkitischen, also griechisch-katholischen Gemeinschaft, wurde von seiner Mutter aber auf eine jesuitisch-französische Schule geschickt, um dem englischsprachig-protestantischen Einfluß seines Vaters zu entgehen.
Aus dieser historischen Distanz argumentierend findet der Autor die Toleranz oft nicht dort, wo man sie vermutet. Der Islam hat eine viel ältere Toleranztradition als das Christentum: Wären seine Vorfahren Muslime gewesen in einem christlich beherrschten Land, schreibt Maalouf, dann wäre er kaum in der Religion und am Ort seiner Ahnen geboren. Jahrhundertelang habe der Islam ein "Toleranzprotokoll" befolgt, als Toleranz für die christlichen Gesellschaften ein Fremdwort war, und noch am Ende des vergangenen Jahrhunderts habe Istanbul, die Hauptstadt des damals mächtigsten islamischen Staates, eine nicht-muslimische Bevölkerungsmehrheit gehabt: Man stelle sich einmal die Muezzinrufe aus allen Quartieren Londons, Wiens oder Berlins um die letzte Jahrhundertwende vor.
Daraus entwickelt der Autor die interessante Kernfrage seines Essays. Wie kommt es, daß dennoch gerade die christliche Tradition eine offene Gesellschaft hervorbrachte, während die arabisch-islamische Welt seit bald einem Jahrhundert in unbeweglichen Mythen erstarrt ist? Maalouf bietet statt tief schürfenden Antworten eher Differenzierung im Fragen. Die Öffnung der Gesellschaft zur Moderne, so führt er aus, war in Europa ein fünfhundertjähriges Spiel von Druck und Gegendruck zwischen Wissenschaft und Religion. Was sich im Westen als langsame Selbstentwicklung vollzog, brach andernorts jäh als das "Andere" herein. Selbst dort, wo dieser Einfluß zunächst offen aufgenommen wurde, sei das Ergebnis mißlungen. Maalouf nennt das Beispiel des ägyptischen Vizekönigs Mehmed Ali im neunzehnten Jahrhundert, der ähnlich wie Peter der Große in Rußland durch die massive Einführung westlicher Bildung, Wissenschaft und Technik sein Land reformieren wollte, bis er den europäischen Mächten zu stark wurde und eine gemeinsame Militäroperation sein Tun unterbrach.
Dieses Beispiel treibt arabische Intellektuelle laut Maalouf noch heute zum bitteren Verdacht, "daß der Westen nicht möchte, daß man ihm ähnelt, er will nur, daß man ihm gehorcht". Mit seiner komplementären Gegendarstellung sucht Maalouf das unproduktive Klischee vom "islamischen Fundamentalismus" aus der Debatte von Intoleranz und Identitätssucht zu räumen. Dieser sei nicht Ursache, sondern allenfalls Konsequenz: Als die europäische Nationalidee in das zerfallende Osmanische Reich eindrang und im Vorderen Orient aus vielfachen Gründen nach und nach alle politischen Optionen der Selbstbestimmung fehlschlugen, sei der Religionsfundamentalismus als irrige Restoption geblieben. Auf diese nicht ganz neue Einsicht lassen die konkreten Beobachtungen des Migranten Maalouf ein ungewohntes Gegenlicht fallen, das für Leser beidseits der Schattengrenze Nord-Süd, Ost-West klärend sein sollte.
JOSEPH HANIMANN
Amin Maalouf: "Mörderische Identitäten". Aus dem Französischen von Christian Hansen. Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2000. 144 S., br., 18,90 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Michael Wirth zeigt sich diesem Buch gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt, allerdings räumt er ein, dass Maaloufs These, die arabische Welt fühle sich - auch aufgrund der Geschichte - vom Westen bevormundet, nicht wirklich neu ist. Auch die Vorschläge für bessere Beziehungen zwischen Islam und Christentum "kommen über den bloßen Appell nicht hinaus", so der Rezensent. Doch insgesamt hat Wirth dieses Buch offenbar mit großem Gewinn gelesen. Nicht nur, dass er Maalouf als prädestiniert für dieses Thema erachtet (der Autor gehört, so Wirth, einer griechisch-katholischen Glaubensgemeinschaft im Libanon an und lebt in Paris). Besonders interessant scheint der Rezensent die vom Autor dargestellten historischen Hintergründe für dieses Gefühl einer Bevormundung zu finden, etwa wenn Maalouf auf westliche Einmischung in Ägypten im 19. Jahrhundert eingeht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH