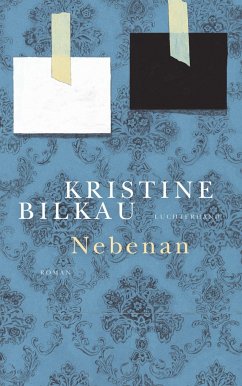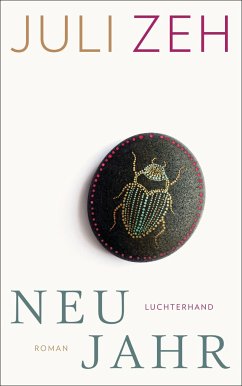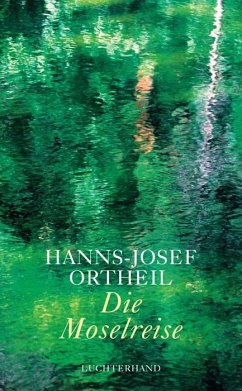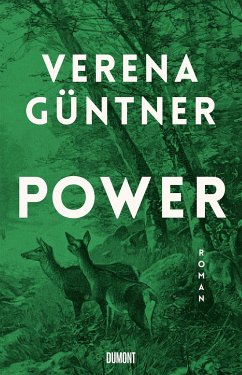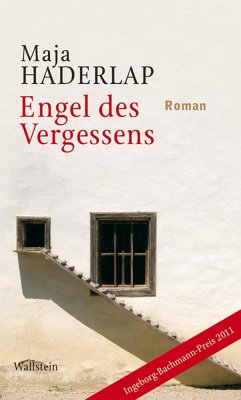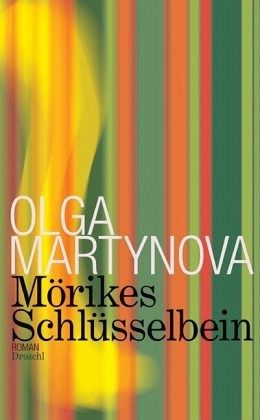
Mörikes Schlüsselbein
Roman. Mit dem Kapitel "Ich werde sagen: Hi!", das mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 2012 ausgezeichnet wurde
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
22,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Tiefsinnig, geistreich und leichtfüßig: ein verführerisches Porträt einer Welt, in der Sinnlichkeit und Literatur sich nicht im Weg sind.Der Roman enthält auch das Kapitel "Ich werde sagen: "Hi!"", mit dem Olga Martynova den Bachmann-Preis 2012 gewonnen hat.Mit einem Kapitel aus ihrem zweiten Roman hat Olga Martynova im Juli 2012 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Wie sie in diesem Preis-Kapitel mit leichtester Hand die Motive rund um den Protagonisten verwob, bis daraus ein strahlendes Beispiel für die Souveränität der Literatur im (oder sogar über das) Leben entstand, so bewegen ...
Tiefsinnig, geistreich und leichtfüßig: ein verführerisches Porträt einer Welt, in der Sinnlichkeit und Literatur sich nicht im Weg sind.Der Roman enthält auch das Kapitel "Ich werde sagen: "Hi!"", mit dem Olga Martynova den Bachmann-Preis 2012 gewonnen hat.Mit einem Kapitel aus ihrem zweiten Roman hat Olga Martynova im Juli 2012 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Wie sie in diesem Preis-Kapitel mit leichtester Hand die Motive rund um den Protagonisten verwob, bis daraus ein strahlendes Beispiel für die Souveränität der Literatur im (oder sogar über das) Leben entstand, so bewegen sich die (scheinbaren) Gegensätze Literatur und Leben, Dichtung und Alltag, Geschichte und Gegenwart, Russland, Amerika und Deutschland, Traum und Realität auf beschwingteste Weise durch den ganzen Roman.Marina und Andreas sind ein mehr oder weniger stabil verheiratetes russisch-deutsches Paar in den besten Jahren, in ihrem Freundeskreis Schriftsteller, Dichter, Künstler: der Sinologe Pawel kennt zwar nach wie vor hunderte von chinesischen Gedichten auswendig, vergisst aber, was vor einer Stunde war, der Ballerina Antonia sind die Menschen ausgegangen, denen sie von ihren Tourneen Geschenke mitbringen kann, und aus dem Russisch-Studenten John ist ein Agent geworden.Und während der alte russische Dichter Fjodor stirbt, werden gerade wieder neue Künstler geboren: Andreas' und Marinas Sohn Moritz wird zum Dichter, ihre Tochter Franziska zur Malerin. Mit feinstem Sinn für die Realität, einem offenen Blick für das Phantastische und dem für sie typischen Humor erzählt Olga Martynova von der Selbstfindung und der Situation des Künstlers in der Gegenwart - und verbindet das auch noch mit einem Schuss Agentenroman.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.