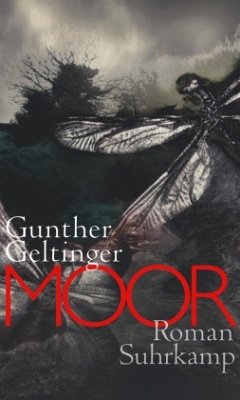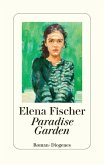Er ist dreizehn und wächst ohne Vater auf. Er stottert und heißt wie kein anderes Kind im Dorf, in der Schule: Dion. Dion Katthusen, Außenseiter unter den Gleichaltrigen, Einzelkind, Libellensammler in einer Moorlandschaft voller Mythen und Legenden. Am Ende seiner Kindheit erzählt er seine Geschichte: von der Sehnsucht nach einer intakten Sprache, vom Verhältnis zu seiner Mutter, einer erfolglosen Malerin, die ihr Scheitern in der Kunst und im Leben mit ihrer grenzüberschreitenden Liebe zum Sohn kompensiert. Doch wie der morastige Boden am Rand des norddeutschen Dorfes, in dem er aufwächst, ist auch Dions Sprache voller Löcher und Spalten. Unfähig, erzählend das Chaos in ihm und um ihn zu ordnen, leiht er seine Stimme einem Gegenüber, das ihm von allen am nächsten scheint: seiner Kindheitslandschaft. Und lässt so das Moor für ihn sprechen. Was Menschen tun, um der Einsamkeit zu entkommen, wie sie andere verletzen, um die eigene Versehrtheit an Körper und Seele auszuhalten, und was sie dabei der Liebe zumuten und abverlangen, davon erzählt dieser Roman - sprachmächtig, bildmächtig, kühn; und mit einer den Naturgewalten abgelauschten Erzählerstimme, die dem Leser buchstäblich den Boden unter den Füßen entzieht.

Schon an seinem Schauplatz kann ein Roman scheitern: Gunther Geltinger hat sein jüngstes Buch in einer geschwätzigen Leidenslandschaft angesiedelt
Wenn es gut läuft für den Jungen Dion, wenn also seine Mutter hinreichend nah und die Grenze zwischen ihr und ihm gerade richtig gezogen ist, dann ist auch das Moor eine Landschaft voller Verheißungen. Dion wohnt seit dem Tod des Vaters, der Bauer war, allein mit seiner Mutter im norddeutschen Fenndorf, im letzten Gebäude hinter den Ställen. In der Früh, wenn die Mutter ihr Bad im Teich nimmt, kann er den Wind in den Binsen hören. Er sieht den Dampf in den Gräben, "das unentschlossene Licht zwischen den Stämmen", und die Mutter, nackt, "ihr Spiegelbild auf dem Wasser". Dann ist es sehr laut in dem Kind, das schon fast erwachsen ist, aber eben nur fast.
Gunther Geltinger lässt die Phantasien dieses verstummten Dreizehnjährigen mit wuchtiger Sprache zirkulieren, und man muss sich manchmal davor schützen wie vor zu viel Innenwelt. In prallen Sätzen breitet sich das Elend des zu früh Erwachsenwerdens vor dem Leser aus: erste Sehnsucht nach zärtlicher Berührung, wenn der Junge seinen Finger in ein Mooskissen steckt; der Ekel beim Schnuppern an der mütterlichen Unterhose; die Libellen, die er ersatzweise liebt und penibel untersucht. So wie ein Sonderling ohne Freunde das tut: mit Lexikonwissen. Gerne vermischt Dion sein biologisches Wissen mit den Wunschfantasien über eine Schulkameradin, die darin zur liebesbereiten Partnerin wird: "Neben dir rauscht Tanja empor, das rote Kleid ausgebreitet zu Flügeln". Bis Tanja ihre Arme "flink kreiselnd" durch die Luft bewegt "wie das flirrende Rad eines Propellers", bis Dion endlich Anlauf nimmt für diesen Höhepunkt, dem unbedingt nötigen symbolischen Akt der Befreiuung aus dem Würgegriff einer durchweg beklemmenden Atmosphäre, ist schon viel geschehen und wieder zerbrochen in diesem Roman.
Ein Albtraum mit durchaus starken, surrealistischen Passagen ist das. Aber ebenso ein Sozialdrama, das leider nicht nur bei der Perspektive dieses gebrochenen Jungen bleibt, sondern unbedingt auch der anderen Seite, der völlig überforderten Mutter, eine Stimme mehr überstülpt als verleiht. Marga bekommt viel Raum. Eine Zugezogene, vor vierzehn Jahren von einem ihrer Freier in dieses Kaff verschleppt, hat sie so gar nichts Warmes. Im besten Fall duftet sie nach Lavendel, meistens aber stinkt sie nach Alkohol, nach Schlafschweiß und Abgestandenem. Tablettensüchtig seit Jahren, pendelt sie immer noch täglich in die Stadt, wo sie bei einem Herrenausstatter mit Hinterzimmer arbeitet. Bald hat sie sich an dieses Leben gewöhnt, und mehr schlecht als recht hilft sie sich über Widersprüche mit Launen hinweg. Mal kocht sie ausgiebig, dann wieder gar nicht. Mal nimmt sie Anteil an Dion, dann wieder gar nicht. Mal hat sie deswegen ein schlechtes Gewissen, dann wieder vergisst sie ihren Sohn ganz. Eigentlich wollte sie Malerin werden, hatte aber keinen Erfolg. Den Abend, an welchem ihr die Zukunftslosigkeit klarwird, bestimmt sie zu ihrem letzten. Der Selbstmordversuch im Bett ihres Sohnes, den sie im Schlaf mit Erbrochenem begießt, misslingt. "Sauer, voll abgestorbenem Leben", so ist der Geruch dieser Szene, die einen Wendepunkt einleiten könnte. Sie findet sich etwa in der Mitte dieses aus vielerlei Stimmen angerichteten Buches, das alles, aber auch alles einfangen will und die Wirklichkeit wortreich verwandelt. Andererseits zerschellt es an ebendieser Wirklichkeit, am zermürbenden Vorführen ihrer ganzen Trostlosigkeit. Als dürfe zur Rechtfertigung dieses Schrift gewordenen Racheaktes eines Sohnes kein Beweismittel ausgelassen werden.
Gunther Geltinger hat Film studiert und beweist Sinn für anspruchsvolle erzählerische Formen. Schon sein erster Roman "Mensch Engel" (2010) handelte von Enttäuschungen und wie sie mit Sprache zu überleben seien. Das nötige Sprachvermögen hat er und den Mut zum Risiko ebenfalls. Er beschreibt die karge Landschaft nicht nur in kraftvollen Bildern, er lässt das Moor sprechen. So liegt es vor uns, als Leidenslandschaft, ein schwarzer Kadaver, "überzogen von eiternden Kratern und Heidegrind, mit einem Bohlenweg als künstlicher Wirbelsäule, gedränt, zerstochen und abgeplaggt". Ökologen wollen es retten mit kompliziertem Gerät, doch trotz aller Bandagen "winde ich mich in hohem Fieber, blute ich aus, magere ab und verröchele". Vielleicht hätte ja das Fieber gereicht.
Offenbar will Geltinger hier gegen die gesamte Droste-Hülshoff-Schauerromantik spielen. Es gilt, das Moor von Klischees zu befreien. Exzessiv hat er recherchiert und sein "artifizielles Literaturmoor" geschaffen, das die Menschen um sich herum verschlingt und ausspeit, im besten Fall spiegelt als "nicht lebendig noch gänzlich tot". Was auf den ersten Blick noch beeindruckt, erweist sich auf den zweiten Blick und bei anhaltender Lektüre als unsauber geschliffen. "Zischende" Bustüren oder Augen, die auf eine Frau "deuten", was doch eher ein Zeigefinger macht, mag man noch hinnehmen. Anstrengend wird jedes Stilmittel erst in der Redundanz. Die permanente Ansprache an ein "du", die Geltingers selbstzweifelnde Figuren unter Überwachung des ordnenden, aber selbst von allem betroffenen Erzählers stellt, nimmt den Szenen viel von ihrer Lebendigkeit. Und selbst wenn genau das anvisiert ist, wenn die Sprache als Mittel dienen soll, die Kälte dieser Beziehungen gegen die sprudelnde Bildgenerierungsmaschine des völlig überforderten Jungen zu markieren, so läuft diese anfangs so reiche Sprache allmählich ins Leere. Dies nicht zuletzt, weil nie recht klarwird, was denn nun diesen Erzähler, jenen schon erwachsenen Dion, antreibt, das alles mitzuteilen. Da hilft es wenig, dass er selbst zunehmend genervt ist: "Mir dauert das alles zu lang", murrt er. Manchmal ruft er seinen Figuren zu: "Also los, Kinder, ein bisschen mehr Mumm und Zack!" Oder er gibt sachliche Regieanweisungen: "Alle ab." Wenn schon der Erzähler die Figuren nicht liebt, liebt sie vielleicht auch der Autor nicht. Warum sollten wir uns dann mit ihnen abgeben?
"Zum Durchschiffen zu trocken, für den Fußmarsch zu nass", heißt es über das Moor. Das Gleiche ließe sich über diesen ambitionierten Roman sagen, der seinen Mitteln nicht vertraut. Man hätte sich diesen Mutter-Sohn-Konflikt als konzise Erzählung gewünscht. Ein paar Nebenfiguren und Adjektive weniger, weil sie sich in der Häufung gegenseitig schwächen; entschiedenere Wechsel zwischen den Tonarten: Dann wäre der Text nicht überladen, sondern vielleicht ein gelungenes Kammerstück.
ANJA HIRSCH.
Gunther Geltinger: "Moor". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2013. 440 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Christoph Schröder vermutet, dass es an dem starken Bücherherbst dieses Jahres liegt, dass Gunther Geltingers zweiter Roman "Moor" unbeachtet geblieben ist - zu wenig beachtet jedenfalls, findet der Rezensent. Das Buch konfrontiert den Leser auf großartige Weise mit sämtlichen Zumutungen der Dorfwelt, alles ist "schicksalsbesetzt" und "psychosengesättigt", erklärt der Rezensent, und Geltinger tut das in einer überbordenden Sprache, die dem kaputten Sprechen des stotternden Protagonisten, der sich später selbst als Autor entpuppt, den Kampf ansagt, fasst Schröder zusammen. "Wenn K und D gemeinsam aufmarschieren, kannst du nur die Waffen strecken", heißt es an einer Stelle im Roman, doch Dion Katthusen - schon sein eigener Name ist ihm eine Qual, weiß der Rezensent - schreibt wütend gegen die Sprachlosigkeit an, berichtet Schröder. Besonders hat den Rezensenten die Perspektive fasziniert, die Geltinger gewählt hat: das Moor selbst erzählt die Geschichte, verrät Schröder.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Die Frage, warum die Krankheiten der Seele zurzeit auf so interessante Weise in die Romane der unmittelbaren Gegenwart drängen, wäre eine ausführliche Betrachtung wert. Gunther Geltinger hat sich auf diesem Feld mit seinem intensiven, packenden, mutigen, rätselhaften Roman Moor einen vorderen Platz gesichert.« Ina Hartwig Süddeutsche Zeitung 20140122