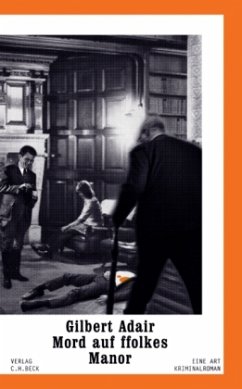Es ist Weihnachten 1935. Ein verschneites Herrenhaus am Rande von Dartmoor. Ein weihnachtliches Abendessen bei Colonel Roger ffolkes mit Freunden des Hauses und oben, im Dachgeschoss, die Leiche von Raymond Gentry, einem Klatschkolumnisten und Erpresser, mit einem Einschussloch im Herzen. Aber die Tür zum Dachzimmer war von innen verschlossen, das einzige Fenster ist mit dicken Eisenstangen vergittert, und natürlich findet sich keine Spur vom Mörder oder seiner Waffe. Glücklicherweise (für den Mörder leider weniger) ist einer der Gäste an diesem Abend die fabelhafte Evadne Mount, die erfolgreiche Bestsellerautorin zahlloser klassischer Krimis. Und wäre sie nicht in dieser Sache die geforderte Spürnase, "Mord auf ffolkes Manor" könnte geradezu von ihr selbst verfasst worden sein.

Für Gilbert Adair wird's mit dem Tod des Autors erst richtig lustig
Für gewöhnlich steht die Aufklärung am Ende des Kriminalromans, hier schon im ersten Satz: "So etwas kann man sich eigentlich nur in Büchern vorstellen", brummt Roger ffolkes (sic). Der Mord in der von innen verriegelten Dachstube seines Landsitzes erinnert den Colonel an die Krimis von Evadne Mount, dem prominentesten Gast seiner Weihnachtsgesellschaft. Ihre Spezialität sind verwickelte, "irreführende Spielchen", die einen grotesken Grundeinfall ad absurdum führen: Brudermord unter Zwillingen, Mord im Hosenbügler oder auch im Traum. In Mrs. Mounts Landhauskrimis wird selbst das Wasserkochen zum abgründigen Problem; dabei weiß sie, daß der perfekte Mord "einfach und uninteressant" ist und nur ohne logischen "Schnickschnack" funktioniert.
"Mord auf ffolkes Manor" ist perfekt und kompliziert, ein Pasticcio nach Art Agatha Christies und zugleich ein vertracktes Literaturrätsel. Gilbert Adair ist nicht umsonst ein Postmoderner der unterhaltsameren Sorte: Der Tod des Autors ist bei ihm der Anfang detektivischer Lust. Schon in seinem gleichnamigen Roman ließ er einen Ich-Erzähler über sein Ableben hinaus schwadronieren; in "Blindband" brachte ein blinder Schriftsteller seinen Mörder und Biographen aus dem Grab heraus zur Strecke.
Natürlich enthält "Mord auf ffolkes Manor" alle Zutaten des klassischen "Cozy"-Krimis: kryptische Zettel und flackerndes Kaminfeuer, Tweedsakkos und dottergelbe Kostüme, blinde Motive, falsche Fährten und eine sinnlose Grundrißskizze. Der Tatort ist ein abgelegenes Landhaus in Dartmoor; der Fall eines jener locked room mysteries, die seit Poe die kleinen grauen Zellen beschäftigen, das Opfer ein nicht zur Gentry gehörender Unsympath namens Raymond Gentry, der Detektiv ein pensionierter Scotland-Yard-Inspektor mit Schnauzbart und Pfeife, der die üblichen Verdächtigen reihum verhört.
Die Regeln des Spiels sind bekannt. "To play the game ist Ehrensache", schrieb Krimifan Brecht einmal. "Der Leser wird nicht getäuscht, alles Material wird unterbreitet, bevor der Detektiv das Rätsel löst." Das ist freilich nur die halbe Wahrheit. Whodunnits sind so rational konstruiert wie Schachrätsel oder Staubsauger. Aber während sie noch Verdachtspartikel, Indizienbrösel und Motivfeinstaub zusammenkehren, kommt Sand ins Getriebe der kriminellen Logik, und am Ende kann der Erfinder der Denksportaufgabe seinen Kopf nur aus der Schlinge ziehen, indem er ihn preisgibt. "Der ganze Witz eines Kriminalromans", beschrieb Agatha Christie einmal ihr Strickmuster, "besteht darin, daß einer der Mörder sein muß, es aber ebenso offensichtlich aus irgendeinem Grunde nicht sein kann. Obwohl er es natürlich ist." In "The Act of Roger Ackroyd" zerstörte sie das Gewebe, indem sie beim Häkeln eine Masche fallen ließ: Wenn der Ich-Erzähler der Mörder ist, wird der Vertrag zwischen Autor und Leser aufgekündigt. Adairs Roman heißt im Original nicht zufällig "The Act of Roger Murgatroyd". Allerdings gibt sich der Erzähler-Täter spät zu erkennen, und daß er sich einst mit dem Verfassen schlechter Krimis durchschlug, macht die Sache nicht gerade einfacher. Verdächtig sind natürlich alle Anwesenden, selbst Inspektor Trubshaw und die große alte Dame des Krimis. Alle sind Hochstapler, Trickser, Lügner, jedenfalls "viel zu perfekte Engländer, um echt zu sein". Echt ist nur ihr Haß auf den Toten. Gentry war ein scharfzüngiger Klatschkolumnist, der mit der "Peitsche seiner Bosheit" ihre Lebensart, ihren ländlichen Geschmack und selbst ihre Krimis ("Nichts als warmes Bier und Hundenarren und alte Jungfern, die im Nebel mit dem Fahrrad zur Andacht fahren") lächerlich machte und bei jedem eine Leiche im Keller fand. Der Vikar, der sich in seinem Kriegsruhm sonnt, war ein Feigling vor dem Herrn; Doktor Rolfe hat ein Alkoholproblem und peinliche Kunstfehler zu verbergen, die exzentrische Diva eine dunkle Vergangenheit als Kokainistin und Lesbe, und der Hausherr ist weder Colonel noch heißt er ffolkes. Selbst das Personal, mokiert sich in der Küche mit klassenkämpferischem Grimm und literaturkritischem Behagen über die snobistischen Pinkel, deren Nackenhaare sich immer kursiv sträuben und die sich doch nicht zu fein für Mord in guter Gesellschaft sind. So kramt Adair tief in der billigen Trickkiste Agatha Christies und zieht deren verblichenes Tafelsilber, fadenscheinige Kostüme, Marotten und Sprachspiele wie ein schlechter Zauberer aus seinem Hut: alles Larifari, Küchenpsychologie, fauler Zauber, aber durchaus einer unverschwitzten Parodie wert.
Am Ende treibt Trubshaw schwarze Schafe und schweigende Lämmer zum Showdown in der Bibliothek zusammen. Was man sich nur in Büchern vorstellen kann, muß auch unter und in ihnen zu Ende geführt werden: Der Mörder, ein Faktotum und wie jeder gute Autor unsichtbar und allwissend, wird durch seine Sprache überführt. Adair gestattet sich nur zwei kleine Abweichungen von den Regeln: Alle Verhöre werden öffentlich geführt, niemand darf lügen. So wird das Ideal demokratischer Wahrheitsfindung und logischer Verläßlichkeit radikalisiert und dementiert. Nicht, daß er auf die Geheimgänge und "red herrings" aus der Rumpelkammer Christies verzichtete - "Mord auf ffolkes Manor" ist selber eine Falltür, die ins Leere führt, ein Selbstentfesselungstrick im geschlossenen Raum.
Derlei Übungen verrutschen leicht ins Gemachte, in virtuose Mimikry oder unterkühlte Experimente. Hier kommt der Liebhaber postmoderner Dekonstruktionen wie der naive Leser altmodischer Konstruktionen auf seine Kosten. Man fühlt sich rasch heimisch in dieser plüschigen Mördergrube, wo die Treppen verräterisch knarzen und die Scharniere höhnisch knirschen. Daß die Meta-Spannung aus lauter Versatzstücken und Imitaten auf- und am Ende nach allen Regeln der Kunst wieder abgebaut wird, tut dem Vergnügen an dieser "Aufführung eines Kriminalromans im richtigen Leben" überhaupt keinen Abbruch.
MARTIN HALTER.
Gilbert Adair: "Mord auf ffolkes Manor". Eine Art Kriminalroman. Aus dem Englischen übersetzt von Jochen Schimmang. C. H. Beck Verlag, München 2006. 294 S., geb., 18,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Ganz aus dem Häuschen ist Rezensent Yaak Karsunke über so einen feinen, eleganten britischen Kriminalroman und verkündet eine "glanzvolle postmoderne" Auferstehung des Genre. Die Heldin und Rätsellöserin sei eine Art Agatha Christie, die als Kriminalschriftstellerin in Konkurrenz zu einem pensionierten Scotland-Yard-Inspektor ihren ersten locked-room-Fall angehe. Ort der Handlung ist ein Landsitz bei Dartmoor, die Tatzeit Weihnachten 1935, also eine rundherum klassisch anmutende Szenerie, mit der Gilbert Adair genauso kunstvoll und anspielungsreich "jongliere" wie mit den übrigen typischen Ingredienzien dieses Genre britischer Provenienz. Seine Glanzmomente, bekennt der Rezensent freimütig, habe der Krimi immer dann, wenn man sich als Leser dabei ertappe, wie man trotz alle der Anspielungen von der Fiktion übermannt werde und beispielsweise mit den Figuren mitleide. In diesem "Tonlagenwechsel" zwischen ironischem Zitat und Spannung liege der "Hauptreiz" der Lektüre. Lobenswert seien aber auch die überragenden Formulierungskünste des Autors, die dank einer trefflichen Übersetzung auch im Deutschen voll zur Geltung kämen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH