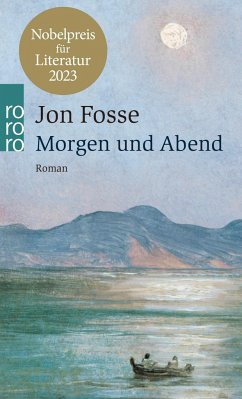In «Morgen und Abend» erzählt Jon Fosse von einem großen Thema, dem Tod. Die Geschichte, in deren Mittelpunkt ein einfacher norwegischer Fischer steht, dessen Leben hart und erfüllt war, öffnet den Blick auf das, wovon heute kaum noch jemand spricht. Eine kunstvoll rhythmisierte, ganz schlichte Erzählung, die bezaubert und berührt.
«Vermutlich hat es in den letzten Jahren kein traurigeres, aber zugleich auch kein fröhlicheres, tröstenderes Buch gegeben über den Morgen des Lebens und den Abend des Todes.» (Elke Heidenreich)
«Vermutlich hat es in den letzten Jahren kein traurigeres, aber zugleich auch kein fröhlicheres, tröstenderes Buch gegeben über den Morgen des Lebens und den Abend des Todes.» (Elke Heidenreich)

Jon Fosses Grenzgänge des Lebens / Von Heinrich Detering
Aus guter Musik, glaubt der norwegische Fischer, kann man "von dem, was Gott ihm sagen will, ein bißchen was hören". Denn "gute Musik drängt die Welt beiseite, aber das mag Satan nicht, und deswegen sorgt er immer für so viel Lärm". Das Buch, in dem diese Vermutung angestellt wird, macht gute Musik. Dabei ist es nicht nur ganz leise, sondern auch bemerkenswert kurz. Was auf dem Titelblatt als "Roman" annonciert wird, umfaßt nicht viel mehr Wörter als der Verlagsprospekt. Es hat auch nur ganz wenig zu erzählen. Aber dieses Wenige ist so schön, daß Satan diesmal vergebens lärmt.
"Morgen und Abend", die jüngste Erzählung des Dramatikers Jon Fosse, berichtet von einem Leben, in dem nichts Besonderes geschehen ist, dem Leben eines Fischers an der norwegischen Westküste; eigentlich wird nicht einmal dieses Leben erzählt, sondern nur sein Anfangs- und sein Endpunkt, die Stunde der Geburt und die des Sterbens, mehr nicht. Von diesen beiden Ereignissen aus fallen manchmal Lichtstrahlen in die Zukunft oder Vergangenheit und lassen die Spuren eines Lebenslaufs aufleuchten; beiläufig erfahren wir allerlei über diesen Mann, seine Eltern, seine Frau und seine Tochter. Doch nicht um die Biographie geht es, sondern um ihre Grenzen; nicht um den Tag, sondern um Morgen und Abend.
Ein kleiner Junge kommt zur Welt; das ist das erste Kapitel. Die beiden anderen erzählen, wie ein alter Mann morgens erwacht, im Bett seinen Gedanken nachhängt und zwischen Wachtraum und Vision nach und nach begreift, daß dies die letzten Stunden seines Lebens sind. Er ist derselbe, dessen Geburt das erste Kapitel geschildert hat, und nun ist seine Zeit um. Aber was heißt hier Zeit? Für den ungeduldigen Vater im Kreißsaal sind endlich "der Tag und die Stunde da und jetzt dauerte und dauerte das", und wenn dann die Geburt überstanden ist, spürt er etwas wie den "Atem von einem ruhigen Ort außerhalb der Welt". Die letzte halbwegs genaue Zeitangabe des Textes, beim Blick des Erwachenden auf die Taschenuhr, lautet "viertel nach"; noch unbemerkt beginnt die Stunde schon gleichgültig zu werden.
Was von nun an geschieht, vollzieht sich fast ausschließlich im Inneren dieses Sterbenden - und, wer weiß, auch dem des schon Gestorbenen. Denn wann genau der Augenblick des Todes eintritt, erfahren wir nicht. Allein das unauffällige Detail, daß das dritte Kapitel keine Nummer mehr trägt, sondern vom vorigen nur durch ein weißes Blatt abgesetzt ist, gibt zu verstehen, daß sich hier ein Übergang vollzieht, daß die linear verstreichende Zeit sich auflöst. So unmerklich gleitet das Geschehen zwischen Traum und Wirklichkeit hin- und herüber, daß eine genaue Grenzziehung unmöglich, ja daß schon die Frage nach ihr unangemessen und taktlos wäre.
Fosse ist ein Virtuose der gleitenden Übergänge. Sanft und präzise notiert er die allmähliche Entstellung der Wahrnehmungen, das Verschwimmen der Orte und das Verschwinden des Körpergefühls. Er läßt uns sehen und hören, wie in den Wahrnehmungen des alten Mannes die Lebensalter ineinander überzugehen beginnen, wie die ihm begegnenden Figuren gleichzeitig jung und alt sind und wie die Ehefrau, von der er sich wünscht, sie sei noch am Leben, im nächsten Augenblick ja tatsächlich am Leben ist, wäre nur ihre Hand nicht so kalt; wie er auf einmal bemerkt, daß der Nachbar, mit dem er sich seit einigen Minuten unterhält, schon lange tot ist und trotzdem so ruhig dastehen und immer wieder den einen Satz sagen kann, der wie ein Gongschlag langsam lauter wird: "Nein was bist du alt geworden."
Noch dringlicher als dieser Satz allerdings beschäftigt den Sterbenden die Frage, ob es nicht wieder höchste Zeit zum Haareschneiden wäre, denn "all die Jahre haben sie einander die Haare geschnitten, Peter und Johannes, ja das haben sie und viel Geld gespart auf diese Weise", und nun hat der alte Freund auf einmal so langes, graues und bis zur Durchsichtigkeit dünnes Haar. Es ist der einfache und genau geschilderte Alltag, aus dem Johannes langsam herausstirbt; nichts Plötzliches geschieht, sondern eine langsame Entfremdung und Verklärung des Gewöhnlichen. Sie beginnt damit, daß der zum Sterben Erwachende sein morgendliches Schlafzimmer in einem fremden Licht sieht, wenn sich die Dinge anfühlen, "als hätten sie gar kein Gewicht", wenn es scheint, als könne gar das Haus selbst "jeden Augenblick in den offenen Himmel hinaufschweben". So beginnt auch die Bootsfahrt "nach Westen übers Meer" an diesem Morgen beinahe so wie immer, nur daß der Pilker, den er mit dem Netz auswirft, nicht mehr zum Grund sinkt, sondern schwebend im Wasser stehen bleibt. Die Ahnung, daß es diesmal zugleich auch ein anderes Gewässer ist, auf das Johannes hinausfährt, zeichnet sich nur wie ein Muster unter den sanft schaukelnden Sätzen ab, in der Verschiebung eines Motivs: aufs Meer hinaus geht es, übers Meer geht es, dahin, "wo Meer und Himmel ineinander übergehen".
Mutwillig segelt Fosse hinein in die tückischen Strömungen zwischen Arte povera und Kitsch. Sein Text gleitet durch die Klippen der Sentimentalität so leicht und selbstverständlich hindurch, wie hier die Lebenden durch die Toten hindurchgehen (und Hinrich Schmidt-Henkel hat das exzellent übersetzt). Nur einmal, am Ende, wagt er sich etwas zu weit hinaus und gerät ins seichte Fahrwasser der Esoterik. Da werden dann um die Behauptung, daß jenseits dieser Grenze die Wörter verschwinden, etwas zu viele Worte gemacht; der einzige Mißklang in dieser schönen Musik.
Denn so eng die Erzählung den inneren Vorgängen ihrer Figuren folgt, so wenig redet sie doch mit der verstellten Stimme einer fingierten Naivität. Von Beginn an macht sich ein souverän arrangierender Erzählers bemerkbar - nicht ausdrücklich, sondern in der Phrasierung der Tempora und Perspektiven, im Verschwinden und Wiederauftauchen von Interpunktionszeichen, in denen sich die Wellenbewegung von Zeitempfindung und Zeitaufhebung abzeichnet, in den dahinströmenden und innehaltenden Sätzen, im Wechsel zwischen lyrisch dichten Passagen und der Auflösung der Wörter ins Lautmaterial.
Während die Erzählung den Bewußtseinsströmen ihrer Helden folgt, vollziehen sich erstaunliche Perspektivenwechsel so still, daß man sie beinahe überliest: wie sich während der Darstellung der Geburt, noch ehe man es recht bemerkt hat, der Text nicht mehr in den Empfindungen der Mutter befindet, sondern in denen des Kindes; wie der Sterbende auf der Straße zu gehen und seiner Tochter zu begegnen meint, wie seine Tochter geradewegs durch ihn hindurchgeht und wie, genau in diesem Augenblick und mitten im Satz, die Perspektive aus dem Kopf des Vaters in den der Tochter hinüberwechselt, die nun "denkt, nein was denn, da ist ihr doch etwas entgegengekommen, und dann ist sie mitten da hindurchgegangen". Immer vollzieht sich hier das schwebende Entgleiten der Wirklichkeit in so unmerklich kleinen und kunstvollen Textbewegungen.
Für Grenzerfahrungen wie diese haben sich die Fischer in Fosses Buch ihre etwas unorthodoxe Art des Christentums zurechtgelegt, in der eben beispielsweise die Beziehungen zwischen guter Musik, Gott und Satan erörtert werden, zwischen Glaube, Welt und Kunst. Auch sonst geht es darin nicht besonders dogmatisch zu, und letzte Festlegungen hat Johannes immer vermieden. Daß Gott allmächtig ist und allwissend, daran hat er nie geglaubt, oder jedenfalls "nie so besonders". Aber fromm ist er doch, nur ist "sein Gott wahrscheinlich, wenn er es denn sagen muß, nicht von dieser Welt". Dies aber ist die Bedingung dafür, daß diese Welt - wahrscheinlich, wenn er es denn sagen muß - von Gott ist. Denn es muß wohl sein Geist sein, "der in all dem ist und es zu mehr als nichts macht".
Mehr als nichts: Fosses Geburts- und Sterbegeschichte erzählt von dem Wunder, daß nicht nichts ist. Seine Protagonisten sind keine Helden des einfachen Lebens, und ihre Armut ist kein Glanz von innen. Ihr Leben kommt nur in die Welt, und es verschwindet aus ihr, und dazwischen, das ist das Erstaunliche, ist es da. Das ist eigentlich alles.
Jon Fosse: "Morgen und Abend". Roman. Aus dem Norwegischen übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel. Alexander Fest Verlag, Berlin 2001. 120 S., geb., 29,14 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Die Geschichte des Fischers Johannes, eines einfachen, alten Mannes. Er erinnert sich an sein vergangenes Leben, an diejenigen Menschen, die ihm am meisten bedeutet haben, seine Frau und sein Freund Peter, beide längst verstorben. Johannes' Sehnsucht wird sich an diesem Tag erfüllen. Als seine Tochter am nächsten Morgen nach ihm sieht, ist er tot. Jon Fosse ist ein schlichtes, ein sehr leises, fast bezauberndes Buch gelungen." - Handelsblatt
Vermutlich hat es in den letzten Jahren kein traurigeres, aber zugleich auch kein fröhlicheres, tröstenderes Buch gegeben über den Morgen des Lebens und den Abend des Todes. Elke Heidenreich