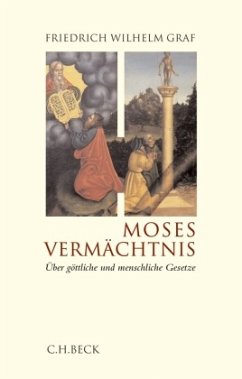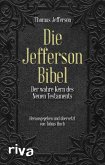Der renommierte Theologe und Religionswissenschaftler Friedrich Wilhelm Graf erläutert in seinem eleganten Essay, wie die Vorstellungen vom göttlichen Gesetz entstanden sind, welche Ausprägung sie in den verschiedenen Religionen erfahren haben und warum sie bis heute so machtvoll sind, daß sie immer wieder - und in letzter Zeit verstärkt - zu gewaltsamen Konflikten führen.
Die Diskussionen um die religiöse Verankerung von Verfassungen und Amtseiden, um das Kopftuch im öffentlichen Dienst und das Kruzifix in Schulen, um den Schutz ungeborenen Lebens oder den Verfassungsauftrag zur "Bewahrung der Schöpfung" zeigen, daß die Vorstellung vom "Gesetz Gottes" trotz Aufklärung und Säkularisierung eine nahezu ungebrochene Suggestivkraft entfaltet. Diese geht für manche religiöse Gruppen wieder so weit, daß sie das göttliche Recht dem staatlichen Recht vorordnen und damit die Geltungskraft des "positiven Rechts" unterminieren. Friedrich Wilhelm Graf bringt daher auch die Strategien zur Konfliktvermeidung und Beschränkung des göttlichen Gesetzes zur Sprache, die die Religionen selbst entwickelt haben.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Die Diskussionen um die religiöse Verankerung von Verfassungen und Amtseiden, um das Kopftuch im öffentlichen Dienst und das Kruzifix in Schulen, um den Schutz ungeborenen Lebens oder den Verfassungsauftrag zur "Bewahrung der Schöpfung" zeigen, daß die Vorstellung vom "Gesetz Gottes" trotz Aufklärung und Säkularisierung eine nahezu ungebrochene Suggestivkraft entfaltet. Diese geht für manche religiöse Gruppen wieder so weit, daß sie das göttliche Recht dem staatlichen Recht vorordnen und damit die Geltungskraft des "positiven Rechts" unterminieren. Friedrich Wilhelm Graf bringt daher auch die Strategien zur Konfliktvermeidung und Beschränkung des göttlichen Gesetzes zur Sprache, die die Religionen selbst entwickelt haben.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Bei allem Unterscheidungsspaß nicht unkorrekt: Friedrich Wilhelm Graf beobachtet Himmel und Erde
Am Ende, wenn die Bücher aufgetan werden, wird alles klar und deutlich vor Augen stehen. Denn dann wird Gott zu erkennen geben, nach welchem Recht er in Wahrheit zu richten gedenkt. Es wird sich zeigen, was richtig und falsch, was gut und böse war. Zuvor bleibt nur die - in Toleranz ertragene oder durch Aggression verdrängte - Unsicherheit der Gläubigen, ob denn ihr Gottesgesetz das wahre sei, ob sie den echten Ring tragen. Und es bleibt die Möglichkeit, den Theologen als Kulturwissenschaftler zu befragen. Denn dieser überschaut den Konflikt zwischen religiös-absolut begründeten Normen einerseits und Rechtsfindung im freiheitlichen und multikulturellen Staat andererseits - und mahnt zu gewaltfreier Konfliktfähigkeit.
Friedrich Wilhelm Graf spricht mit seinem Essay in einer Situation, die in der medialen Öffentlichkeit als Wiederkehr des Religiösen und als zunehmend konfliktträchtige Auseinandersetzung zwischen verschiedenen religiös begründeten Norm- und Ethossystemen untereinander und mit dem weltanschaulich neutralen Staat wahrgenommen wird. Der Absolutheitsgestus zumal der drei monotheistischen Weltreligionen, ihr Anspruch nicht nur auf das Glauben, sondern auch auf das Handeln ihrer Anhänger, verträgt sich, so scheint es, nicht mit der für das friedliche Zusammenleben unabdingbaren Selbstrelativierung, ja dem Verzicht. Graf hütet sich vor einseitigen und vordergründigen Schuldzuweisungen. Er schreitet mit der oft wiederholten Denkfigur "Einerseits - andererseits" bekennend voran.
Wider klerikale Spezialmoral
Mit Sympathie liest man, der Autor "verachte klerikale Moralrechthaberei" und "sehe in individueller Freiheit das höchste innerweltliche Gut". Der Bezug auf Kant ist ebenso deutlich erkennbar wie eine protestantische (freilich nicht die protestantische) Lesart des Wirklichen, die zwischen zwei Reichen zu unterscheiden weiß und zu einer Entkoppelung von Glaube und Moral tendiert. Die Unterscheidung von Legalität und Moralität wehrt der (für Amerika als Faktum ausgemachten) Entwicklung zu einem "Sittenstaat".
Den Religionen wird gleichwohl ein hoher funktionaler Wert zuerkannt, indem sie "den in ihnen vergemeinschafteten Frommen" helfen, "die elementaren Negativitätserfahrungen endlichen Lebens als sinnerfüllt zu deuten". Dem Rechtstaat wird empfohlen, religiöse Lernprozesse hin zu vernünftiger Religion zu "stimulieren, indem er als Kulturstaat durch gelassene Liberalität verhindert, als Kulturkampfstaat erlebt zu werden". Gleichwohl soll und kann der Staat nicht Erzieher sein. Das Gegen- und Schreckbild sind "positiver Kirchenglauben" und vom Autor wahrgenommene "Ansätze kontraproduktiver Klerikalisierung der ethischen Konfliktdiskurse". Fragt man weiter, wo denn konkret in der Bundesrepublik der Klerus sein Haupt erhebt, wird man auf die "klerikale Spezialmoral" in der "Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und anderer Gerichte bis in die 1960er Jahre hinein", auf den religiös zu einseitig besetzten nationalen Ethikrat und - natürlich - auf Bischof Huber und Kardinal Lehmann mit ihrer Mahnung zu "zivilreligiösen Glaubensbekenntnissen" verwiesen. Graf sieht noch oder wieder für die Gegenwart die Gefahr, Deutschland könne als "tendenzchristlicher Konfessionsstaat" wahrgenommen werden. Solche bedenklichen Entwicklungen mag man in Bayern sensibler registrieren als in Brandenburg. Doch das Rettende wächst schon, in Gestalt der wahrgenommenen "Pluralität religiöser Ethosformen" und einer Stärkung der relativen "Autonomie weltlichen Rechts".
Innerhalb der so abgesteckten Grenzen darf der protestantische Bundespräsident durchaus "Gottes Segen" zum neuen Jahr wünschen, doch Kreuz und Kopftuch gehören nicht zur Berufskleidung von Richtern und Staatsanwälten. Die Grenzziehung zwischen "religionssymbolischer Zurückhaltung" der staatlichen Repräsentanten und Religionsfreiheit, die auch "subjektiv erlebbar" sein soll, bleibt also schwierig. Denn die Schaffung religionssymbolfreier öffentlicher Räume habe, so lehre wiederum das Beispiel Amerika, den Konflikt nicht entschärft. Eine weitherzige und historisch informierte Bestimmung dessen, was alles zur abendländischen Kultur gehört, könnte wohl auch helfen.
Diese Bekenntnisse und Zuspitzungen, die etliches scharf erfassen und sich nur bisweilen und dem zweiten Blick ihrerseits als politisch recht korrekt erschließen, markieren natürlich ebenfalls eine explizite religiöse Option. Dennoch entgeht die Darstellung nicht immer der Versuchung, die religiöse und ethische Position des einzelnen oder der (immer minoritären) Glaubens- und Überzeugungsgemeinschaft zu kontrastieren mit dem sich im Recht manifestierenden Konsens des großen Ganzen. Die zur Problemanzeige geschilderten Konflikte um das Kopftuch der muslimischen Lehrerin an der staatlichen Schule oder um das Schächten sind ja in zwei Richtungen zu lesen: vom religiösen Individuum her, das sein Recht auf freie Religionsausübung gegen den Staat erstreiten will - und vom Staat her, der mit seiner Rechtssetzung und Rechtsprechung erheblich (manche meinen: immer mehr und jedenfalls zu viel) in die Lebensgestaltung des einzelnen eingreift.
Diejenigen, die nicht geduldig bis zum Jüngsten Tag warten mögen, blicken auf den Anfang, auf die Urszene des mit göttlicher Autorität ausgestatteten Rechts: Mose empfing am Sinai die Zehn Gebote auf steinernen Tafeln, so interpretiert Deuteronomium 4,13 die Sinai-Szene. Das ist für Graf, anders als vielleicht für Jan Assmann, keine Sündenfallgeschichte. Nein, für "Multikulti-Fröhlichkeit", "Poly-Götter", "Polygamie" oder "gruppenspezifische Ordnungsentwürfe" statt einer für alle gültigen Rechtsordnung ist der Autor nicht zu haben. Hinter der vordergründig eindeutigen Berufung von Judentum, Christentum und Islam auf Mose scheint aber eine vielfach (überwiegend aus der christlichen Tradition) illustrierte Geschichte der differenzierten Inanspruchnahme und Auslegung der Zehn Gebote auf. Diese ist geeignet, den Anspruch selbst zu relativieren und den Dekalog als "grandiose Projektionsfläche für unterschiedlich akzentuierte Normenentwürfe" zu erweisen. Das Gottesgesetz gibt es nur im Plural, die "fromme Fiktion" ist überaus geschichtsmächtig, gerade in ihren sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Das "kluge Historisieren der Exegeten" hingegen, welche den Ursprung der Norm als historisch kontingent und gewachsen aufzeigt, erweist sich angesichts der Wirkungsgeschichte als kraftlos. Geschichte wird als Rezeptions- und Wirkungsgeschichte geschrieben; die Frage nach dem echten Ring ist irrelevant.
Bedenke das Ende!
Von seiner Warte erkennt der Theologe, daß andere Urszenen des Rechts den Konflikt nicht lösen: nicht die Berufung auf ein vorstaatliches Natur- oder Sittengesetz, nicht der Verweis auf Menschenrechte oder Werte oder gar eine gemeinsame kulturelle Prägung der Staatsbürger (Paul Kirchhof). Dies kann schon deshalb nicht gelingen, weil solche Verweise als "liberaler Legitimationsmythos" und mit "religiösen Pathosformeln" versehen die religiöse Urszene - und damit die ihr inhärenten Konflikte - beerben. Auch als notwendiges Postulat scheint Graf das "Aeternitätsparadox moderner Verfassungsgebung" nicht der Ausweg. Denn sub specie Dei leben wir unausweichlich im Vorletzten. Der Autor beschreibt besonnen, wie im Vorletzten die Berufung auf das Unbedingte auszuhalten sei.
Doch kennt die christliche Tradition eine Urszene, die Grafs Essay nur eben streift: Die Predigt auf dem Berg in Galiläa ist ja nicht nur Fortschreibung der "traditio legis" (Gesetzesübergabe); und der Bergprediger verkündet anderes als den Dekalog. Durch Feindesliebe und Rechtsverzicht als Zentrum einer eschatologischen Moral entwickelt das Fleisch gewordene Gotteswort im politischen Raum subversive Kraft, welche die Göttlichkeit bestehender Ordnungen fundamental in Frage stellt. Christlicher Monotheismus ist, recht verstanden, keine Legitimation des Prinzips göttlicher Monarchie durch das Gottesrecht. Von solchem Ende der Gesetzes-Geschichte aus zu denken implizierte allerdings eine höchst positive Theologie.
HERMUT LÖHR
Friedrich Wilhelm Graf: "Moses Vermächtnis". Über göttliche und menschliche Gesetze. Verlag C. H. Beck, München 2006. 97 S., 22 Abb., br., 12,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Lobend äußert sich Rezensent Uwe Justus Wenzel über dieses Buch des Theologen und Theologiehistorikers Friedrich Wilhelm Graf, das sich mit dem komplexen Verhältnis von Religion und Politik befasst. Er betont, dass Graf den Schwierigkeiten des Themas nicht aus dem Weg geht. Im Gegenteil: Graf sondiere die Vielschichtigkeit der religionspolitischen Lage der Gegenwart und registriere Überlagerungen und Verwerfungen in den vielfältigen religiösen Traditionen und verschiedenen politischen Formationen. Wenzel sieht Grafs Position von einem liberalen Kulturprotestantismus geprägt, mit dem er durchaus sympathisieren kann. Auch Grafs Plädoyer für eine "gelassene Liberalität" des Staates im Umgang mit den Religionen erscheint Wenzel überzeugend.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH