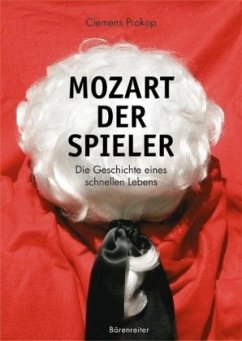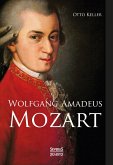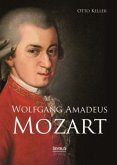Er war Wunderkind und Teufelskerl, Spaßvogel und Arbeitstier. Aber kein Genie, das vom Himmel gefallen ist. Wolfgang Amadeus Mozart bleibt eine schillernde Figur: Seine Musik begeistert und rührt, seine Opern bestimmen Spielpläne, seine Person ermuntert zu den wildesten Spekulationen.Clemens Prokop erzählt die Geschichte eines hochbegabten Komponisten, der sich ein schnelles Leben lang auf der Reise zu sich selbst befindet, dabei von anderen lernt und ihre Inspiration braucht. Er lichtet den Wildwuchs von Anekdoten und Analysen, um einen neuen, persönlichen und erfrischend jungen Blick auf die Jahrtausendfigur zu ermöglichen. Clemens Prokop entdeckt dabei einen Spieler, der nicht nur auf Tasten zaubert und mit Musik experimentiert, sondern lustvoll mit Worten jongliert und Komponieren als intellektuelles Spiel begreift.Clemens Prokop ist Musikkritiker und Feuilletonist. Er schreibt für die Financial Times und diverse Rundfunkanstalten.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Der Spielforscher Günther Bauer über die Spielernatur Mozarts
Wer war Mozart "wirklich"? Letztlich wissen wir nicht allzuviel Genaueres. Eines immerhin läßt sich, zumal im Vergleich mit Beethoven, sagen: Ein konsistentes, auf klare ästhetisch-moralische Maximen gegründetes Weltbild hatte er kaum; in seinen Meinungen, Urteilen, Vorlieben und Abneigungen schien er eher emotional, sprunghaft, auch widersprüchlich. Für eine "gesetzte" Persönlichkeit wurde er nicht alt genug. Den Ideen von Aufklärung, Josephinischen Reformen, selbst Französischer Revolution gegenüber aufgeschlossen, frohlockte er gleichwohl über den Tod Voltaires. Und während Beethoven mit gutem Grund Muzio Clementi schätzte, aktivierte der Komponist unvergleichlicher italienischer Opern gegen ihn Ressentiments wider "welsches" Virtuosentum. Und in genau dem Ausmaß, in dem Beethoven, der "Titan", zur hehrsten Werte-Instanz des deutschen Bildungsbürgertums stilisiert wurde, sah man in Mozart den ewig jugendlich tändelnden Götterliebling. Daß der tiefe Ernst von Mozarts Musik und eine mitunter eher leichtfertig-verspielte Persönlichkeit sich nicht ausschließen müssen, gehört zum Charakterbild des in mancher Hinsicht so Frühreifen wie kindlich Gebliebenen.
Daß Mozart spielerische Züge besaß, ist oft hervorgehoben worden - sei es in der fingertrommelnden Dauernervosität nicht zuletzt des Pianisten, in den frivolen Sprachscherzen der "Bäsle"-Briefe wie auch im Hang zu Gesellschaftsspielen aller Art. Dem vor allem ist der Salzburger Mozart- wie Spielforscher Günther G. Bauer nachgegangen, akribisch den Vergnügungen des Komponisten auf der Spur: Billard, Kegel, Karten- und Brettspiele, "Bölzlschießen", selbst erotisch verfängliche Pfänderspiele, Lotto und bisweilen derbe oder auch verrätselte Sprach-, Satz- und Wortverdrehungen werden hier sowohl biographisch tüftelig als auch zeit- und sittengeschichtlich weit gefächert dargestellt.
Die Salzburger, Mailänder, Mannheimer und Wiener Zeitvertreibe des auch nach Ablenkungen aller Art suchenden Künstlers werden in ein reiches historisches Panorama gestellt: Über Mozart wie über die hauptsächliche österreichische Gesellschaft der Jahre 1763 bis 1791 erfährt man allerlei Wissenswertes und Neues. Doch die Fülle des Materials täuscht ein wenig über die allzu vereinheitlichende Sicht auf die Vergnügungswelt des Rokoko hinweg; und sosehr beim homo ludens Glück und Geschicklichkeit zusammengehören, so klar sind die strukturellen Unterschiede, vor allem, was die Zufallskomponenten betrifft. Bauer reduziert Mozart auf die vielfältige Spielernatur, überbewertet ein wenig uniform eine Seite.
Gerade solch penibel kenntnisreiche Fokussierung auf ein Thema läßt Defizite zutage treten. Man erfährt zwar über dieses und jenes mancherlei Aufschlußreiches; doch ausgerechnet die Frage, ob und wie weit Mozart um Geld gespielt hat, seine Finanzmisere aus Spielschulden resultierte, muß Bauer offenlassen, seine an sich sympathische Reserve gegenüber Spekulationen führt in die Enge. Die psychologische, gar psychoanalytische Sonde setzt er entsprechend gleich gar nicht an. Was trieb Mozart, der auch mit "Trazom" unterschrieb, zu seinen Wortspielen und Sinnverkehrungen, abstrus-absurden Sprachoperationen im quasi musikalisierten Briefstil? War dies nur spätpubertäre Lust an der Verwirrung, am semantisch-phonetischen Vexierbild? Hatte die Spielleidenschaft nicht auch ihre dämonisch gefährdenden Züge? Und steckt im Jonglieren mit mobilen Strukturen innerhalb eines eher festen Rahmens nicht auch ein neues, alte Ordo-Prinzipien konsequent negierendes Moment?
Denn unschwer läßt sich die unberechenbare Dramaturgie des Opernkomponisten auch als Krisenreflex deuten, zumindest als rationalistisch-skeptischer Einspruch wider die These von der ein für allemal denkbar besten aller Welten. Daß da Ponte und Mozart auf "Così fan tutte" verfielen, ist symptomatisch, konterkariert die fatale Liebeswette doch alle Schwüre auf stabil-hohe Beziehungen, bei denen die Paare, ganz wie Karten, immer wieder neu gemischt werden können. Wenn Mozart einem Theaterautor nahe ist, dann Marivaux und dessen "Spiel von Liebe und Zufall". Steckt in "Così" nicht der Keim für Pirandellos "Sechs Personen suchen einen Autor"?
Wie authentisch Mozarts Entwürfe, mittels Würfelspiel baukastenartig kleine Stücke zu erstellen, tatsächlich sind, bleibe dahingestellt. Edwin Ortmann hat, der Anleitung folgend, "Nie wieder Mozart - Ein Spielroman" verfaßt. Falls Mozart derlei Zufallsoperationen ernst genommen hat, dann könnte dies ein Schlaglicht aufs eigene Komponieren werfen: Bei manchen Menuetten etwa kann der Eindruck des quasi aus Fertigteilen Zusammengesetzten entstehen. Denkbar immerhin wäre sogar eine etwas andere Reihenfolge der Einzelteile. Zumindest im Vergleich mit Beethovens meist eher hypotaktischem Komponieren wirken die Mozarts nicht selten parataktisch nebeneinandergereiht.
Ob in der F-Dur-Klaviersonate KV 332 oder im Patchwork der "Zauberflöte": Der Eindruck des "So und nicht anders muß es ein für allemal sein" des Gesamtablaufs ist keineswegs immer absolut evident. Damit soll Mozart nicht zum Vorläufer des Aleatorikers John Cage gemacht werden. Doch über musikalischen Zusammenhang, unterschiedliche Dichtegrade zu sinnieren gehört zur Herausforderung großer Musik.
GERHARD R. KOCH.
Günther G. Bauer: "Mozart". Glück, Spiel und Leidenschaft. Verlag Karl Heinrich Bock, Bad Honnef 2003. 400 S., 69 Abb., geb., 28,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Nichts für zarte Gemüter sind diese Einblicke ins Leben Mozarts, findet Rezensent Joachim Kaiser - und auch nichts für "grüblerische Pedanten". Dafür eignet es sich aber für potenziell an Mozart Interessierten, die weder mit einem "klammen Verehrungston" als auch mit einem "spezifischen Fachjargon" viel anfangen können. Der Preis für die "frische, flotte" Vermittlung von Informationen ist, dass der Tonfall manchmal doch sehr flapsig wird und den Leser zum "Zusammenzucken" bringen kann, wie Kaiser aus seiner Leseerfahrung berichtet. Doch Unterhaltungswert haben die zusammengetragenen Anekdoten auf jeden Fall.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH