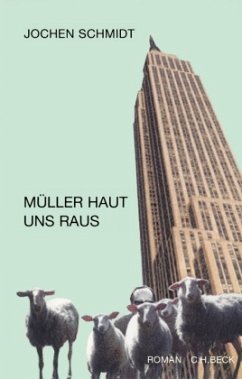In Jochen Schmidts erstem Roman befindet sich der Ich-Erzähler in einer fatalen Situation: Er leidet an einer halbseitigen Gesichtslähmung, kann deshalb nur noch grinsen und muß ins Krankenhaus. Die Ursache für diese Erscheinung kann entweder Streß oder die Entspannung nach Streß sein, und ähnlich klar fällt auch die Selbstanalyse des Helden aus. Irgendetwas ist schief gelaufen, und weil sein Körper nicht mehr weiterzuwollen scheint, läßt er die Jahre nach der Wende noch einmal Revue passieren.
Er wollte so geheimnisvoll wirken wie Heiner Müller, oder wenigstens so traurig wie J.D. Salinger, aber gleichzeitig in einer Punk-Band Gitarre spielen. Dabei gerät er in einen Kreis von Künstlern und Pseudokünstlern um den Maler Anselm und lernt dort Judith kennen, was sein Leben vom ersten Tag an verkompliziert. Er geht mit ihr in die französische Provinz, trifft dort Lucía, sein spanisches Schlamassel, und verliebt sich in Deborah, weil sie wie Woody Allen und der Break-Dance ausNew York kommt. Aber seine Suche nach der Liebe scheitert immer wieder an seiner Unfähigkeit, sich zu entscheiden, und die angehäuften Erinnerungen machen ihm zusehends zu schaffen.
Mit entwaffnender Selbstironie, einer bestechenden Beobachtungsgabe, mit Schwung und voller Komik erzählt Jochen Schmidt in diesem Roman, wie schwer und wie kurios es ist, in Zeiten universeller Ironie und gegen alle Widerstände sein Ziel zu verfolgen.
Er wollte so geheimnisvoll wirken wie Heiner Müller, oder wenigstens so traurig wie J.D. Salinger, aber gleichzeitig in einer Punk-Band Gitarre spielen. Dabei gerät er in einen Kreis von Künstlern und Pseudokünstlern um den Maler Anselm und lernt dort Judith kennen, was sein Leben vom ersten Tag an verkompliziert. Er geht mit ihr in die französische Provinz, trifft dort Lucía, sein spanisches Schlamassel, und verliebt sich in Deborah, weil sie wie Woody Allen und der Break-Dance ausNew York kommt. Aber seine Suche nach der Liebe scheitert immer wieder an seiner Unfähigkeit, sich zu entscheiden, und die angehäuften Erinnerungen machen ihm zusehends zu schaffen.
Mit entwaffnender Selbstironie, einer bestechenden Beobachtungsgabe, mit Schwung und voller Komik erzählt Jochen Schmidt in diesem Roman, wie schwer und wie kurios es ist, in Zeiten universeller Ironie und gegen alle Widerstände sein Ziel zu verfolgen.

Lob des Hypochonders: Jochen Schmidts Nachwende-Roman
Die Ärzte sind ratlos. Sie wissen nicht, wie sie den jungen Mann mit der Gesichtslähmung behandeln sollten. Neurophysiologische Ursachen für dessen linksseitiges Dauergrinsen sind nicht zu finden. Er selbst vermutet, es müsse sich um einen Fall von Seelenhypochondrie handeln. Die Lähmung trat am Tag nach der 0:3-Viertelfinalniederlage gegen Kroatien auf, die für die deutsche Nationalmannschaft das WM-Aus bedeutete. Damit muß er das eigene Leben wiederaufnehmen; alle bis nach der WM aufgeschobenen Entscheidungen sind jetzt nachzuholen. Ein Schock also? Oder bloß eine Folge der heimtückischen Zeckenbißkrankheit, die noch nach zwanzig Jahren zu Lustlosigkeit, Müdigkeit und Pech in der Liebe führt?
Jochen Schmidt hat bereits bei seinen Auftritten auf Berliner Lesebühnen von dieser schrecklichen Episode aus seinem Leben erzählt. In seinem ersten Roman "Müller haut uns raus" durchleidet nun der Held Jochen Schmitt, der mit dem Autor bis auf einen einzigen Buchstaben identisch ist, diese Krankheit. Er begreift die Nervenattacke als Mahnung des Körpers, die Angst vor der Erinnerung zu überwinden und sich noch einmal dem fast schon vergessenen Jahr in Brest zuzuwenden, jenem trostlosen, wunderbaren Jahr, das er als das wichtigste in seinem Leben betrachtet. Eine gesunde Dosis Hypochondrie erweist sich als Bedingung des Schreibens. Denn nur, wer zu leiden versteht, hat etwas zu verbessern, und nur wer etwas verbessern möchte, will seine Erlebnisse noch einmal erzählend wiederholen.
Am flottesten geht Schmidt respektive Schmitt das Schreiben von der Hand, wenn er von seiner "grundlosen Traurigkeit" erzählt, für die es viele Gründe gibt: Berliner Hinterhoftristesse, Brester Vereinsamung, fortgesetzter Liebeskummer. Am melancholischen Rand der Gesellschaft, wo der Putz bröckelt, die Kohlen für den Ofen knapp sind und das alte Pflaster regennaß glänzt, fühlt er sich wohl. Wie schon in dem Erzählungsband "Triumphgemüse" sind deshalb das Ost-Berlin der Nachwendezeit, ein abgelegenes brandenburgisches Dorf und das Theater bevorzugte Aufenthaltsorte. Der Reisedrang hinaus in die Welt führt nun aber nicht mehr wie einst nach Moskau, sondern in den europäischen Westen und schließlich nach New York. Dort, in der U-Bahn, liest Schmitt auf einem Sitz die Worte: "Priority seating for persons with disabilities" und fragt sich, warum es keine speziellen Sitze für Personen gibt, die unfähig sind, richtig zu lieben. Das wäre dann wohl sein Platz im Leben, den er so dringlich sucht und nirgendwo findet.
Bei berühmten Leuten, die er verehrt, wie zum Beispiel Samuel Beckett oder Heiner Müller, ist das Vorhandensein einer tausendseitigen Biographie der Beweis dafür, daß in ihrer Künstlerexistenz alles gutgegangen ist. Jochen Schmidt muß sein Leben einstweilen noch selbst erzählen. Er tut das aber schon deshalb gerne, weil das Leben ansonsten eher langweilig wäre. Unaufgeschrieben bliebe es erschreckend unbedeutend. Nur aus Sicherheitsgründen erklärt er es zur Fiktion, damit die Freunde und Bekannten, die darin vorkommen, sich hinterher nicht bei ihm beschweren. Zur Sprache unterhält Jochen Schmidt ein emphatisches Verhältnis. Das bringt nicht nur eine scheinbar unendliche Lust am Erzählen mit sich, sondern in seinem Fall auch die Leidenschaft, möglichst viele Fremdsprachen zu erlernen. Die Sprache dient wie das Leben dazu, Pointen aufzuspüren. Die Freundin Lucía, der Schmitt in zärtlichen Nächten im französischen Studentenwohnheim den Rücken kratzte, wundert sich über diese seltsame Angewohnheit ihres deutschen Liebhabers. Er glaubte, ihr damit einen Gefallen zu tun, weil er "gratte-moi" verstand, wenn sie "regarde-moi" sagte. Auch so können Rituale entstehen.
"Müller haut uns raus" ist ein Erinnerungsbuch über das Erwachsenwerden in der Nachwendezeit, als im Osten Berlins plötzlich überall Camel-Pyramiden aus Glas angeschraubt wurden und Werbewände die Sicht auf die Fassaden verstellten. Schmidt/Schmitt betrachtet die Insignien der neuen Gesellschaft mit Skepsis und interessiert sich kaum dafür, zielstrebig die Karriereleiter zu erklimmen - es sei denn, als Schriftsteller. Er lehnt traditionelle Arbeitsverhältnisse ab und denkt eher über Grundlohnmodelle nach. So sympathisch zu sein, wie er nun mal ist, hält er für eine Dienstleistung an der Gesellschaft, die honoriert werden müßte. Also bleibt er sitzen, wo er immer schon saß, am Schreibtisch, um versonnen ins nächtliche Dunkel hinauszustarren und dem Leben in Schriftform den letzten Schliff zu geben. Ein Roman ist daraus nicht unbedingt geworden, eher eine Erlebnissammlung, die keine andere Form sucht als die Aneinanderreihung von Anekdoten. Der Wahnwitz liegt dabei im Detail, wie in jener Geschichte aus früherer Jugend, als der Erzähler beim Zahnarzt den Gipsabdruck des Gebisses seiner Angebeteten mitgehen läßt. Zu Hause deponiert er es auf dem Schreibtisch, um es bei Bedarf zu betrachten und die fehlenden Lippen zu imaginieren.
"Der Inhalt wurde doch bei Büchern völlig überschätzt", heißt es an einer Stelle. Das mag sein. Dieses Buch aber besteht aus nichts als Inhalt. Schmidt kann und will seine Herkunft von den Berliner Lesebühnen nicht verleugnen, wo "Literatur" als etwas Künstliches, wenig Erstrebenswertes gilt. Die Lesebühnendichter setzen das Leben direkt in Text um, alles andere ist uninteressant. Die Verweigerung der Form, die dort zelebriert wird, begründet Jochen Schmidt mit einer tiefen Aversion gegen allen Künstlerhabitus, wie er von der DDR-Avantgarde posenhaft zelebriert wurde: "So hatten wir es in der letzten DDR-Zeit erlebt, in der sich Frauen nackt in Farbe wälzten, Männer dazu Baß spielten und Dichter ins Mikrophon schrien. Man konnte wahlweise auch Zeitungen anzünden, lange Texte mit Buchstabennudeln verfilmen oder mit Innereien jonglieren, die Aufmerksamkeit des Publikums war einem sicher, es war ja gar kein Publikum, es waren wir alle. Und man mußte nicht davon leben." Heute aber herrschen die Marktgesetze und damit das Publikum. Schmidt hat daraus wie viele seiner Generationsgenossen die Lehre gezogen, daß es allein aufs Erzählen und auf die Unterhaltsamkeit ankommt. Die Avantgarde ist von gestern und läuft hinterher.
JÖRG MAGENAU
Jochen Schmidt: "Müller haut uns raus". Roman. Verlag C. H. Beck, München 2002. 350 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Dem Autor ist seine Herkunft von einer Berliner Lesebühne anzumerken, so Jörg Magenau, weil er die Form verweigere. Lesebühnendichter setzen ihr Leben "direkt in Text um", erläutert der Rezensent, ihnen sei die Gattung Literatur und überhaupt jeder Künstlerhabitus suspekt. Insofern stellt Jochen Schmidts erster Roman "Müller haut uns raus" für Magenau auch keinen Roman dar, sondern eine Erlebnissammlung, eine Aneinanderreihung von Anekdoten, die er genüsslich zur Kenntnis genommen hat. Denn Schmidt ist von einer unendlichen Erzähllust gepackt, einer Lust auch an der Sprache, mit deren Hilfe sich Pointen aufspüren lassen, lobt Magenau. Witzig und anekdotisch berichten Schmidt alias sein Held Schmitt von der Nachwendezeit in Ostberlin, vom Erwachsenwerden, ersten Reisen, fortgesetztem Liebeskummer, ständig nagender Traurigkeit, die sich am besten schreibend kommentieren und kurieren lasse. Eine "gesunde Dosis Hypochondrie" gehört schließlich zum Schreiben dazu, behauptet der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH