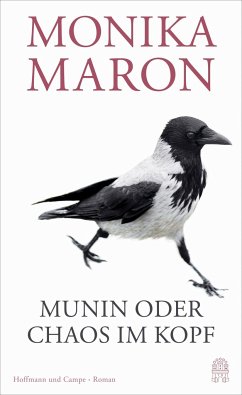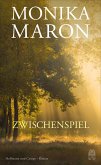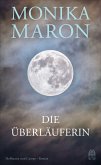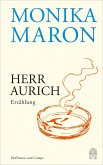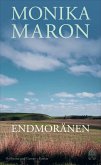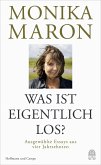Eine kleine Straße - und der Wahnsinn der Welt
Mina Wolf schreibt für die historische Festschrift einer Kleinstadt an einem Beitrag über den Dreißigjährigen Krieg. Während der laute Gesang ihrer Nachbarin sie zwingt, in der Nacht zu arbeiten, kommt es in ihrer kleinen Straße zu Unruhen und in Minas Kopf geraten der Dreißigjährige Krieg mit den aktuellen Nachrichten über Terror und Krieg sowie der schwelenden Aggression in der Nachbarschaft durcheinander. Als sich in dieses Chaos noch die Krähe Munin gesellt und Mina mit großen Fragen konfrontiert, gerät ihre Welt gänzlich aus den Fugen.
Mina Wolf schreibt für die historische Festschrift einer Kleinstadt an einem Beitrag über den Dreißigjährigen Krieg. Während der laute Gesang ihrer Nachbarin sie zwingt, in der Nacht zu arbeiten, kommt es in ihrer kleinen Straße zu Unruhen und in Minas Kopf geraten der Dreißigjährige Krieg mit den aktuellen Nachrichten über Terror und Krieg sowie der schwelenden Aggression in der Nachbarschaft durcheinander. Als sich in dieses Chaos noch die Krähe Munin gesellt und Mina mit großen Fragen konfrontiert, gerät ihre Welt gänzlich aus den Fugen.
Die Angst in ihrem Kopf
Was passiert, wenn sich diffuse Ängste Fakten schaffen und diese mit der Realität verwechseln, beschreibt Monika Maron in ihrem brisanten neuen Roman "Munin oder Chaos im Kopf"
Eine Schriftstellerin schreibt ein Buch über Deutschland. Es ist nicht irgendeine Schriftstellerin. Es ist Monika Maron, berühmt seit ihrem ersten Roman "Flugasche", mit dem sie sich 1981, da war sie 30 Jahre alt, vom zensierten Journalismus in der DDR freischrieb. Bekannt dafür, dem Etikett der "DDR-Autorin" stets entkommen zu sein, weil ihre Geschichten, selbst als sie noch im Osten schrieb, alle möglichen Grenzen im Kopf immer schon überschritten. Gelobt für ihren präzisen Stil. Umstritten wegen ihrer islamkritischen Äußerungen, die man in den vergangenen Jahren bis heute in ihren Zeitungsartikeln findet.
"Munin oder Chaos im Kopf" heißt der brisante neue Roman, der in einer kleinen Straße in Berlin-Schöneberg spielt. Monika Maron wohnt in genauso einer Straße, weshalb man in der Stimme ihrer Ich-Erzählerin - einer Journalistin, die ihre Wohnung nur selten verlässt, weil sie an einer Festschrift über den Dreißigjährigen Krieg arbeitet - die Stimme der Autorin zu erkennen meint. Aber es ist nicht die Autorin, ihr Name ist Mina Wolf. Beim Lesen des neuen Maron-Buchs nicht an die Schriftstellerin Monika Maron und an das zu denken, was man über sie weiß - darin besteht die Hürde, die man nehmen muss beim Eintritt ins Reich ihrer Fiktion. Wenn man wieder herauskommt, ist das anders. Dann geht es darum, zu fragen, was es zu bedeuten hat, wenn jemand wie Monika Maron diese Fiktion entwirft. Aber eben erst im zweiten Schritt. Das ist das Spiel.
Es ist Frühling, aber trotzdem ziemlich düster in Deutschland in diesem Roman. Eine dunkle Wolke schwebt über der kleinen Straße in Schöneberg wie eine Drohung. Vom "Krieg" ist die Rede, von "Terror", von einer "Krise", "Vorkriegszeit", "Ahnung" und einer "Stimmung", die sich seit dem Sommer davor verändert habe: "Die Menschen waren gereizter und je nach Naturell fatalistisch oder aggressiv geworden, was nicht nur die Bewohner unserer Straße betraf, sondern auch alle anderen", heißt es zu Beginn. Hatte eben noch keiner daran glauben wollen, "dass es in Europa je wieder einen Krieg geben könnte", war jetzt "der Krieg sehr nah".
Das kommt wie eine Diagnose daher, ganz so, als besitze es Allgemeingültigkeit; als handele es sich um ein "Stimmungsbild unserer Zeit", wie es der Verlag zu Werbezwecken hinten auch gleich auf den Buchumschlag geschrieben hat und mit aller Selbstverständlichkeit von einer "Zeit aus den Fugen" spricht, die die Zeit sein soll, in der wir leben. Aber so ohne weiteres stimmt das nicht. Denn hier spricht allein Mina Wolf. Monika Maron, das macht ihren Roman so interessant, seziert in "Munin oder Chaos im Kopf" aufs Genaueste die Angststruktur einer Frau, die in der friedlichsten bürgerlichen Großstadtgegend wohnt und sich dennoch bedroht und in ihrer Sicherheit erschüttert fühlt. Es ist eine exemplarische Fallgeschichte, die vorführt, was aus einer vagen Angst werden kann, wenn diese beginnt, sich Fakten zu suchen oder selbst zu schaffen: Überall glaubt ihre Erzählerin, eine "nervöse, leicht explosive Stimmung zu spüren, bei Freunden und Fremden", ob diese Stimmung aber real ist oder bloß im Kopf von Mina Wolf existiert, ist zu Beginn dieses Romans nicht klar: "Vielleicht bildete ich mir das auch nur ein, und die Menschen kamen mir nur so reizbar und missgestimmt vor, weil ich selber reizbar und missgestimmt war."
Und das ist sie tatsächlich. Ihre Reizbarkeit lässt sich auf den Umstand zurückführen, dass sie es bei der Lektüre über den Dreißigjährigen Krieg darauf angelegt hat, Parallelen mit der Gegenwart auszumachen, die sie in einer Art Analogiemanie überall findet. Sie liest ein Buch der britischen Historikerin Cicely Veronica Wedgwood und stellt fest, dass sich heutzutage in Frankfurt zwar nicht Pastoren und Priester prügelten wie damals, und in Dresden auch keine Leichen in Stücke gerissen wurden. Ihrer Wahrnehmung nach flogen auf den Straßen seit einiger Zeit aber beunruhigend viele Fäuste, Steine und Brandkörper, wenn es um religiöse oder politische Glaubensfragen ging. "Aus evolutionärer Sicht", folgert sie reflexhaft, "bedeuteten vierhundert Jahre eben nichts."
Ihre Missstimmung hat auch einen besonderen Grund: Auf dem Balkon des Hauses gegenüber singt regelmäßig eine geistig verwirrte, mit Schleierfetzen kostümierte Frau Opernarien, eigentlich eher ein Jaulen oder Kreischen als ein Singen, das sie zunächst erheitert. Doch hört es nicht auf. Tag für Tag tritt die Sängerin auf ihren Balkon und bringt die ganze Nachbarschaft gegen sich auf. Mina Wolf entzieht sich der Situation. Sie kann bei dem Lärm nicht arbeiten und beschließt, ihre Arbeitszeit in die Nacht zu verlegen, um tagsüber die Auftritte auf dem Balkon gegenüber zu verschlafen. Sie geht also morgens ins Bett, während, von ihr zunächst unbemerkt, in den Häusern um sie herum die Menschen wegen der Singerei die Nerven zu verlieren beginnen, die Polizei einschalten, Nachbarschaftstreffen organisieren, Protest planen, für den sie auch Mina Wolf gewinnen wollen, was ihnen aber nur halb gelingt.
Das ist Monika Marons Versuchsanordnung. Ihr spezieller Trick ist es dabei, ihre in den Krieg vertiefte Erzählerin mit einem speziellen Interesse für den Krieg auslösende Momente auszustatten: "Die Geschichte der Menschen war die Geschichte ihrer Kriege. Die Frage war nur: Warum? Warum landeten wir trotz aller Einsichten und guten Vorsätze immer wieder in irgendwelchen Katastrophen?", überlegt sie - während sie sich selbst auf dem Weg in die Katastrophe befindet. So wie die aufständischen böhmischen Protestanten die kaiserlichen Statthalter samt ihrer Schreiber aus dem Fenster der Prager Burg geworfen und damit ein Fanal gesetzt hatten, fielen 1914 in Sarajevo zwei Schüsse, und alle Welt ahnte, dass in Europa Krieg ausbrechen würde. In "Munin oder Chaos im Kopf" ist der Auslöser, der dem Frieden in der beschaulichen Schöneberger Straße ein Ende macht, die Sängerin. Jedenfalls stellt es sich Mina Wolf so dar, die die Ereignisse um sich herum beobachtet und sie zugleich - das ist die entscheidende Bewegung - mit ihren eigenen, die gesamte Gesellschaft betreffenden Ängsten vermischt. Was sich eben noch allein in ihrem Kopf abspielt, scheint sich in der Welt um sie herum auf diese Weise plötzlich als Realität zu manifestieren und für alle zu gelten. Sie findet unter den Nachbarn auch einzelne, die ihre Befürchtungen teilen. Doch beruht, was sie als Eskalation in ihrer aus einer einzigen Straße bestehenden Welt beschreibt, auf ihrem sehr individuellen Angstcocktail.
Es ist eine Angst, die sie notorisch am Köcheln hält. Dafür braucht sie nicht mehr als ihre tägliche Zeitung. Es ist schon interessant, welche Rolle der Journalismus im Werk Monika Marons spielt. Wie in ihrem ersten Roman "Flugasche" arbeitet auch in diesem die Protagonistin als Journalistin. Doch ist vom aufklärerischen Moment, der am Anfang von "Flugasche" steht, nichts geblieben. Monika Maron selbst war in der DDR als Journalistin für die "Wochenpost" mehrfach nach Bitterfeld gefahren, um dort für ihre Reportage über die Stadt und deren umweltvergiftendes Kraftwerk zu recherchieren. Über die 180 Tonnen Flugasche, die hier täglich herabregneten und ihrem etwas später entstehenden Roman den Namen gaben. Marons Bitterfeld-Reportagen erschienen im wirklichen Leben tatsächlich. Diejenigen ihrer Romanfigur fielen der Zensur zum Opfer, woraufhin diese sich zurückzog, irgendwann einfach zu Hause blieb.
In "Munin oder Chaos im Kopf" ist Marons Erzählerin zwar Journalistin, tritt allerdings lediglich als Zeitungsleserin in Erscheinung, die unreflektiert und obsessiv immer dorthin schauen muss, wo Unheilsmeldungen stehen. Diese sind der Spiritus, der ihre Angst befeuert: Sie findet "Meldungen über zunehmende Vergewaltigungen, Messerstechereien, Raubzüge und sogar Angriffe auf die Polizei, als sei mit den Millionen Menschen, die in den letzten Jahren aus fremden Kontinenten eingewandert waren, auch der Krieg eingewandert, dem sie entflohen waren". Auch das Wort "Vorkriegszeit" findet sie in dem Blatt. Und wenn die Zeitung nicht genug Schreckliches hergibt, sucht sie die Schreckensnachrichten unten auf der Straße, wo ihr jemand von einer jungen Frau erzählt, die nachts ihren Hund ausgeführt habe und dabei überfallen und fast vergewaltigt worden sei - und zwar: von "zwei Männern, von der Frau als südländischer Typ beschrieben".
Monika Maron fährt das volle Programm gängiger Ressentiments auf, um das Bedrohungsgefühl so weit zu steigern, dass die Stimmung kippen und es auf der kleinen Straße in Schöneberg tatsächlich zu einer Art Kriegszustand kommen kann. Sie verlässt den Rahmen der Fallgeschichte dabei nicht. An keiner Stelle macht sie den Roman selbst zum Sprachrohr dieser Ressentiments, was ein Kritiker - erwartbarerweise - trotzdem gleich behauptet, aber nicht genau hingesehen hat. Denn es gibt noch eine andere Figur in diesem Roman, eine Art höhere Instanz, die sich selbst für Gott hält. Und das ist, jetzt wird es etwas sonderbar, eine sprechende Krähe namens Munin. Eines Morgens verschwindet vom Schinkentoast der Mina Wolf, der vom Frühstück noch auf deren Balkon steht, der Schinken. Gegessen hat ihn eine einbeinige Krähe, die sie von nun an immer weiter füttert, in ihre Wohnung lockt, bis sie feststellt, dass diese sprechen kann, woraufhin sie ihr in ihrer Einsamkeit zur wichtigsten Gesprächspartnerin wird.
Sie gibt ihr den Namen Munin und führt mit ihr in den Roman eingestreute, vom Grundton durchweg ironische philosophische Dialoge. Die Krähe ist für Mina irgendwas zwischen Gottheit und Urvernunft. Für die Erzählung aber hat sie eine andere Funktion: Durch sie wird alles, was Mina Wolf sagt, relativiert. Sie ist mit ihren schwarzen Augen die Beobachterin der Beobachterin, die Mina nicht zuletzt dabei zusieht, wie diese sich selbst im Spiegel betrachtet. Was mit ihr und um sie herum passiert, stellt sie auf diese Weise in Frage und macht es als Fallgeschichte sichtbar. Die Perspektive der Krähe - das ist die enorm kunstvolle Konstruktion in Monika Marons beeindruckend konstruiertem Roman - garantiert Distanz. Sie stellt die Angstwelt der Mina Wolf in der Beobachtung aus und wirft sie ihr in den gemeinsamen Dialogen zurück an den Kopf.
Monika Maron hat im vergangenen Jahr in der "NZZ" unter dem Titel "Links bin ich schon lange nicht mehr" einen Artikel veröffentlicht, in dem sie ihren ganzen Ängsten und Ressentiments ungefiltert Raum gab. Sie gehöre zu denen, die "neuerdings als rechts bezeichnet werden", schrieb sie in diesem Text, wozu der "Vorwurf der Islamophobie" gehöre: "Ich habe eine krankhafte Angst vor dem Islam, sagen die Zeitungen und das Fernsehen. Die Wahrheit ist, dass ich vor dem Islam wirklich Angst habe", fügte sie hinzu. Und zählte kopftuchtragende Frauen, den "nach westlicher Macht strebenden Islam" sowie "eineinhalb oder zwei Millionen (so genau weiß es ja keiner) junge Männer, die in den letzten drei Jahren eingewandert sind", als Gründe dieser Angst auf.
Es war ein ärgerlicher Artikel, weil Maron nicht mehr als gängige Klischees bediente, die Genese ihrer Angst nicht reflektierte, sich selbst absolut setzte und am Ende deswegen einfach recht behielt: Links schien sie bei weitem schon lange nicht mehr zu sein. Was in diesem Text fehlte, war die Krähe, die ihr ihre Ansichten zurückspielte, sie mit sich selbst konfrontierte, ihr die Relativität ihrer Perspektive vorführte genauso wie das Zustandekommen ihrer Befürchtungen. Und so offenbart sich eine erstaunliche Diskrepanz: Monika Marons neuer Roman analysiert das "Chaos im Kopf". Er tut dies auf eine exemplarische Weise. In einer brillanten Analyse und mit ihrer unnachahmlich präzisen Sprache geht die Schriftstellerin den Angstzusammenhängen nach, die sie in einer Straße in Berlin-Schöneberg findet - und ist dabei klüger und scharfsinniger als die Leitartiklerin Monika Maron, die sich in ihren Artikeln auf nicht mehr beruft als auf stereotype Thesen, diese aber für enorm wichtig hält, weil sie, Monika Maron, es ist, die sie verkündet.
Die Krähenexpertin ist die Künstlerin, die man bewundert. Der Publizistin dagegen möchte man empfehlen, ein Buch zu lesen, das gerade erschienen ist und das davon erzählt, wie gefährlich es sein kann, wenn man den diffusen Ängsten freien Lauf und sie um sich greifen lässt: "Munin oder Chaos im Kopf".
JULIA ENCKE.
Monika Maron: "Munin oder Chaos im Kopf". Roman. S. Fischer, 224 Seiten, 20 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Was passiert, wenn sich diffuse Ängste Fakten schaffen und diese mit der Realität verwechseln, beschreibt Monika Maron in ihrem brisanten neuen Roman "Munin oder Chaos im Kopf"
Eine Schriftstellerin schreibt ein Buch über Deutschland. Es ist nicht irgendeine Schriftstellerin. Es ist Monika Maron, berühmt seit ihrem ersten Roman "Flugasche", mit dem sie sich 1981, da war sie 30 Jahre alt, vom zensierten Journalismus in der DDR freischrieb. Bekannt dafür, dem Etikett der "DDR-Autorin" stets entkommen zu sein, weil ihre Geschichten, selbst als sie noch im Osten schrieb, alle möglichen Grenzen im Kopf immer schon überschritten. Gelobt für ihren präzisen Stil. Umstritten wegen ihrer islamkritischen Äußerungen, die man in den vergangenen Jahren bis heute in ihren Zeitungsartikeln findet.
"Munin oder Chaos im Kopf" heißt der brisante neue Roman, der in einer kleinen Straße in Berlin-Schöneberg spielt. Monika Maron wohnt in genauso einer Straße, weshalb man in der Stimme ihrer Ich-Erzählerin - einer Journalistin, die ihre Wohnung nur selten verlässt, weil sie an einer Festschrift über den Dreißigjährigen Krieg arbeitet - die Stimme der Autorin zu erkennen meint. Aber es ist nicht die Autorin, ihr Name ist Mina Wolf. Beim Lesen des neuen Maron-Buchs nicht an die Schriftstellerin Monika Maron und an das zu denken, was man über sie weiß - darin besteht die Hürde, die man nehmen muss beim Eintritt ins Reich ihrer Fiktion. Wenn man wieder herauskommt, ist das anders. Dann geht es darum, zu fragen, was es zu bedeuten hat, wenn jemand wie Monika Maron diese Fiktion entwirft. Aber eben erst im zweiten Schritt. Das ist das Spiel.
Es ist Frühling, aber trotzdem ziemlich düster in Deutschland in diesem Roman. Eine dunkle Wolke schwebt über der kleinen Straße in Schöneberg wie eine Drohung. Vom "Krieg" ist die Rede, von "Terror", von einer "Krise", "Vorkriegszeit", "Ahnung" und einer "Stimmung", die sich seit dem Sommer davor verändert habe: "Die Menschen waren gereizter und je nach Naturell fatalistisch oder aggressiv geworden, was nicht nur die Bewohner unserer Straße betraf, sondern auch alle anderen", heißt es zu Beginn. Hatte eben noch keiner daran glauben wollen, "dass es in Europa je wieder einen Krieg geben könnte", war jetzt "der Krieg sehr nah".
Das kommt wie eine Diagnose daher, ganz so, als besitze es Allgemeingültigkeit; als handele es sich um ein "Stimmungsbild unserer Zeit", wie es der Verlag zu Werbezwecken hinten auch gleich auf den Buchumschlag geschrieben hat und mit aller Selbstverständlichkeit von einer "Zeit aus den Fugen" spricht, die die Zeit sein soll, in der wir leben. Aber so ohne weiteres stimmt das nicht. Denn hier spricht allein Mina Wolf. Monika Maron, das macht ihren Roman so interessant, seziert in "Munin oder Chaos im Kopf" aufs Genaueste die Angststruktur einer Frau, die in der friedlichsten bürgerlichen Großstadtgegend wohnt und sich dennoch bedroht und in ihrer Sicherheit erschüttert fühlt. Es ist eine exemplarische Fallgeschichte, die vorführt, was aus einer vagen Angst werden kann, wenn diese beginnt, sich Fakten zu suchen oder selbst zu schaffen: Überall glaubt ihre Erzählerin, eine "nervöse, leicht explosive Stimmung zu spüren, bei Freunden und Fremden", ob diese Stimmung aber real ist oder bloß im Kopf von Mina Wolf existiert, ist zu Beginn dieses Romans nicht klar: "Vielleicht bildete ich mir das auch nur ein, und die Menschen kamen mir nur so reizbar und missgestimmt vor, weil ich selber reizbar und missgestimmt war."
Und das ist sie tatsächlich. Ihre Reizbarkeit lässt sich auf den Umstand zurückführen, dass sie es bei der Lektüre über den Dreißigjährigen Krieg darauf angelegt hat, Parallelen mit der Gegenwart auszumachen, die sie in einer Art Analogiemanie überall findet. Sie liest ein Buch der britischen Historikerin Cicely Veronica Wedgwood und stellt fest, dass sich heutzutage in Frankfurt zwar nicht Pastoren und Priester prügelten wie damals, und in Dresden auch keine Leichen in Stücke gerissen wurden. Ihrer Wahrnehmung nach flogen auf den Straßen seit einiger Zeit aber beunruhigend viele Fäuste, Steine und Brandkörper, wenn es um religiöse oder politische Glaubensfragen ging. "Aus evolutionärer Sicht", folgert sie reflexhaft, "bedeuteten vierhundert Jahre eben nichts."
Ihre Missstimmung hat auch einen besonderen Grund: Auf dem Balkon des Hauses gegenüber singt regelmäßig eine geistig verwirrte, mit Schleierfetzen kostümierte Frau Opernarien, eigentlich eher ein Jaulen oder Kreischen als ein Singen, das sie zunächst erheitert. Doch hört es nicht auf. Tag für Tag tritt die Sängerin auf ihren Balkon und bringt die ganze Nachbarschaft gegen sich auf. Mina Wolf entzieht sich der Situation. Sie kann bei dem Lärm nicht arbeiten und beschließt, ihre Arbeitszeit in die Nacht zu verlegen, um tagsüber die Auftritte auf dem Balkon gegenüber zu verschlafen. Sie geht also morgens ins Bett, während, von ihr zunächst unbemerkt, in den Häusern um sie herum die Menschen wegen der Singerei die Nerven zu verlieren beginnen, die Polizei einschalten, Nachbarschaftstreffen organisieren, Protest planen, für den sie auch Mina Wolf gewinnen wollen, was ihnen aber nur halb gelingt.
Das ist Monika Marons Versuchsanordnung. Ihr spezieller Trick ist es dabei, ihre in den Krieg vertiefte Erzählerin mit einem speziellen Interesse für den Krieg auslösende Momente auszustatten: "Die Geschichte der Menschen war die Geschichte ihrer Kriege. Die Frage war nur: Warum? Warum landeten wir trotz aller Einsichten und guten Vorsätze immer wieder in irgendwelchen Katastrophen?", überlegt sie - während sie sich selbst auf dem Weg in die Katastrophe befindet. So wie die aufständischen böhmischen Protestanten die kaiserlichen Statthalter samt ihrer Schreiber aus dem Fenster der Prager Burg geworfen und damit ein Fanal gesetzt hatten, fielen 1914 in Sarajevo zwei Schüsse, und alle Welt ahnte, dass in Europa Krieg ausbrechen würde. In "Munin oder Chaos im Kopf" ist der Auslöser, der dem Frieden in der beschaulichen Schöneberger Straße ein Ende macht, die Sängerin. Jedenfalls stellt es sich Mina Wolf so dar, die die Ereignisse um sich herum beobachtet und sie zugleich - das ist die entscheidende Bewegung - mit ihren eigenen, die gesamte Gesellschaft betreffenden Ängsten vermischt. Was sich eben noch allein in ihrem Kopf abspielt, scheint sich in der Welt um sie herum auf diese Weise plötzlich als Realität zu manifestieren und für alle zu gelten. Sie findet unter den Nachbarn auch einzelne, die ihre Befürchtungen teilen. Doch beruht, was sie als Eskalation in ihrer aus einer einzigen Straße bestehenden Welt beschreibt, auf ihrem sehr individuellen Angstcocktail.
Es ist eine Angst, die sie notorisch am Köcheln hält. Dafür braucht sie nicht mehr als ihre tägliche Zeitung. Es ist schon interessant, welche Rolle der Journalismus im Werk Monika Marons spielt. Wie in ihrem ersten Roman "Flugasche" arbeitet auch in diesem die Protagonistin als Journalistin. Doch ist vom aufklärerischen Moment, der am Anfang von "Flugasche" steht, nichts geblieben. Monika Maron selbst war in der DDR als Journalistin für die "Wochenpost" mehrfach nach Bitterfeld gefahren, um dort für ihre Reportage über die Stadt und deren umweltvergiftendes Kraftwerk zu recherchieren. Über die 180 Tonnen Flugasche, die hier täglich herabregneten und ihrem etwas später entstehenden Roman den Namen gaben. Marons Bitterfeld-Reportagen erschienen im wirklichen Leben tatsächlich. Diejenigen ihrer Romanfigur fielen der Zensur zum Opfer, woraufhin diese sich zurückzog, irgendwann einfach zu Hause blieb.
In "Munin oder Chaos im Kopf" ist Marons Erzählerin zwar Journalistin, tritt allerdings lediglich als Zeitungsleserin in Erscheinung, die unreflektiert und obsessiv immer dorthin schauen muss, wo Unheilsmeldungen stehen. Diese sind der Spiritus, der ihre Angst befeuert: Sie findet "Meldungen über zunehmende Vergewaltigungen, Messerstechereien, Raubzüge und sogar Angriffe auf die Polizei, als sei mit den Millionen Menschen, die in den letzten Jahren aus fremden Kontinenten eingewandert waren, auch der Krieg eingewandert, dem sie entflohen waren". Auch das Wort "Vorkriegszeit" findet sie in dem Blatt. Und wenn die Zeitung nicht genug Schreckliches hergibt, sucht sie die Schreckensnachrichten unten auf der Straße, wo ihr jemand von einer jungen Frau erzählt, die nachts ihren Hund ausgeführt habe und dabei überfallen und fast vergewaltigt worden sei - und zwar: von "zwei Männern, von der Frau als südländischer Typ beschrieben".
Monika Maron fährt das volle Programm gängiger Ressentiments auf, um das Bedrohungsgefühl so weit zu steigern, dass die Stimmung kippen und es auf der kleinen Straße in Schöneberg tatsächlich zu einer Art Kriegszustand kommen kann. Sie verlässt den Rahmen der Fallgeschichte dabei nicht. An keiner Stelle macht sie den Roman selbst zum Sprachrohr dieser Ressentiments, was ein Kritiker - erwartbarerweise - trotzdem gleich behauptet, aber nicht genau hingesehen hat. Denn es gibt noch eine andere Figur in diesem Roman, eine Art höhere Instanz, die sich selbst für Gott hält. Und das ist, jetzt wird es etwas sonderbar, eine sprechende Krähe namens Munin. Eines Morgens verschwindet vom Schinkentoast der Mina Wolf, der vom Frühstück noch auf deren Balkon steht, der Schinken. Gegessen hat ihn eine einbeinige Krähe, die sie von nun an immer weiter füttert, in ihre Wohnung lockt, bis sie feststellt, dass diese sprechen kann, woraufhin sie ihr in ihrer Einsamkeit zur wichtigsten Gesprächspartnerin wird.
Sie gibt ihr den Namen Munin und führt mit ihr in den Roman eingestreute, vom Grundton durchweg ironische philosophische Dialoge. Die Krähe ist für Mina irgendwas zwischen Gottheit und Urvernunft. Für die Erzählung aber hat sie eine andere Funktion: Durch sie wird alles, was Mina Wolf sagt, relativiert. Sie ist mit ihren schwarzen Augen die Beobachterin der Beobachterin, die Mina nicht zuletzt dabei zusieht, wie diese sich selbst im Spiegel betrachtet. Was mit ihr und um sie herum passiert, stellt sie auf diese Weise in Frage und macht es als Fallgeschichte sichtbar. Die Perspektive der Krähe - das ist die enorm kunstvolle Konstruktion in Monika Marons beeindruckend konstruiertem Roman - garantiert Distanz. Sie stellt die Angstwelt der Mina Wolf in der Beobachtung aus und wirft sie ihr in den gemeinsamen Dialogen zurück an den Kopf.
Monika Maron hat im vergangenen Jahr in der "NZZ" unter dem Titel "Links bin ich schon lange nicht mehr" einen Artikel veröffentlicht, in dem sie ihren ganzen Ängsten und Ressentiments ungefiltert Raum gab. Sie gehöre zu denen, die "neuerdings als rechts bezeichnet werden", schrieb sie in diesem Text, wozu der "Vorwurf der Islamophobie" gehöre: "Ich habe eine krankhafte Angst vor dem Islam, sagen die Zeitungen und das Fernsehen. Die Wahrheit ist, dass ich vor dem Islam wirklich Angst habe", fügte sie hinzu. Und zählte kopftuchtragende Frauen, den "nach westlicher Macht strebenden Islam" sowie "eineinhalb oder zwei Millionen (so genau weiß es ja keiner) junge Männer, die in den letzten drei Jahren eingewandert sind", als Gründe dieser Angst auf.
Es war ein ärgerlicher Artikel, weil Maron nicht mehr als gängige Klischees bediente, die Genese ihrer Angst nicht reflektierte, sich selbst absolut setzte und am Ende deswegen einfach recht behielt: Links schien sie bei weitem schon lange nicht mehr zu sein. Was in diesem Text fehlte, war die Krähe, die ihr ihre Ansichten zurückspielte, sie mit sich selbst konfrontierte, ihr die Relativität ihrer Perspektive vorführte genauso wie das Zustandekommen ihrer Befürchtungen. Und so offenbart sich eine erstaunliche Diskrepanz: Monika Marons neuer Roman analysiert das "Chaos im Kopf". Er tut dies auf eine exemplarische Weise. In einer brillanten Analyse und mit ihrer unnachahmlich präzisen Sprache geht die Schriftstellerin den Angstzusammenhängen nach, die sie in einer Straße in Berlin-Schöneberg findet - und ist dabei klüger und scharfsinniger als die Leitartiklerin Monika Maron, die sich in ihren Artikeln auf nicht mehr beruft als auf stereotype Thesen, diese aber für enorm wichtig hält, weil sie, Monika Maron, es ist, die sie verkündet.
Die Krähenexpertin ist die Künstlerin, die man bewundert. Der Publizistin dagegen möchte man empfehlen, ein Buch zu lesen, das gerade erschienen ist und das davon erzählt, wie gefährlich es sein kann, wenn man den diffusen Ängsten freien Lauf und sie um sich greifen lässt: "Munin oder Chaos im Kopf".
JULIA ENCKE.
Monika Maron: "Munin oder Chaos im Kopf". Roman. S. Fischer, 224 Seiten, 20 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main