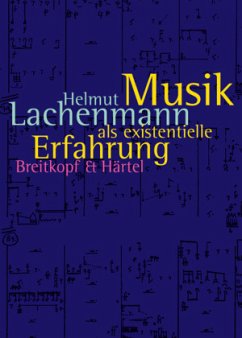"Seine Musik gehört zur ausdrucksvollsten, vielschichtigsten - und dadurch zur reichsten - Musik, die in diesem Jahrhundert komponiert wurde." (Jürg Stenzl)Bei Helmut Lachenmann hat die sorgfältig reflektierte, sprachlich pointierte Äußerung auch im geschriebenen Wort das kompositorische Schaffen von jeher begleitet.Es ist so ein musikliterarisches uvre entstanden, das die Erörterung allgemeiner künstlerischer Sachverhalte und die Eigenanalyse ebenso einschließt wie die Auseinandersetzung mit dem Problemkreis "Musik und Gesellschaft", den Umblick in der Gegenwart wie den Rückblick auf die Tradition.Seine Aufsätze "Klangtypen der Neuen Musik", "Die gefährdete Kommunikation", "Zum Problem des musikalisch Schönen heute", "Musik als Abbild vom Menschen", dazu seine Studien über Mahler, Schönberg und Nono zählen in unserer Zeit zu den wichtigsten Zeugnissen selbstständigen Denkens über Musik. Die Schriften-Ausgabe enthält neben diesen zentralen Dokumenten und einer Anzahl höchst aufschlussreicher Interviews auch sämtliche von Lachenmann verfassten Werkeinführungen sowie die Texte zweier Vorträge Luigi Nonos bei den Darmstädter Ferienkursen 1959/60, die Lachenmann nach den Intentionen seines damaligen Lehrers ausformuliert hat.Der Herausgeber Josef Häusler war als Redakteur für Neue Musik beim Südwestfunk Baden-Baden für die Donaueschinger Musiktage verantwortlich. Er ist mehrfach als Herausgeber und Übersetzer hervorgetreten, vor allem im Zusammenhang mit Pierre Boulez und Claude Debussy. Die Neuauflage 2004 ist im Wesentlichen das Ergebnis einer intensiven und kritischen Lektüre des bisherigen Wortlauts durch Lachenmann selbst. Dabei wurde der Text meist nur geringfügig korrigiert, umgeschrieben oder sprachlich aufgelockert. Neu konzipiert und einschneidend verändert ist lediglich die damals (1996) aktuelle Analyse des zweiten Streichquartetts "Reigen seliger Geister". Inhaltliche Anmerkungen des Herausgebers, Werkverzeichnis und Diskographie sind auf dem neuesten Stand."Dieses Buch kann weder einfach nur benutzt oder gelesen werden. Dieses Buch muss wahrlich studiert werden. Dem Verlag ist zu danken für eine derart kompakte und hervorragend gemachte Buchausgabe."(Bettina von Seyfried, Forum Musikbibliothek)"Ein durchreflektiertes Buch, ja geradezu ein Kompendium zeitgenössischen Musikdenkens."(Opernwelt)

Musik als Denkerfahrung: Die Schriften Helmut Lachenmanns / Von Gerhard R. Koch
Am 26.Januar 1997 wird es an der Hamburgischen Staatsoper eine Uraufführung geben, die als pures Faktum einem Schock gleichkommt - weil Gattung wie Institution fundamental querstehen zu alldem, was man mit dem Komponisten Helmut Lachenmann glaubt assoziieren zu können. Daß seine "Vertonung" von Hans Christian Andersens todtraurigem Märchen "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" nicht dem entsprechen wird, was man gemeinhin unter "Musiktheater" versteht, tut wenig zur Sache: Stockhausens "Licht"-Tage, Wolfgang Rihms "Séraphin", Rolf Riehms "Das Schweigen der Sirenen", Steve Reichs "The Cave", Peter Greenaway / Louis Andriessens "Rosa", Beat Furrers "Narzissus" sind ebenfalls Werke, die mit "Oper" kaum mehr etwas zu tun haben. Doch der Name Lachenmann steht in noch ganz anderer Weise exemplarisch gegen ein Genre, das wie kaum ein anderes Gesellschaft, Tradition, großen Apparat, gewaltige, mythische Botschaften, enorme Gefühle, schönen Schein verheißt, zudem eklatant gegen jegliches Bilderverbot verstößt, vom überreichen abendländischen Fundus zehrt.
Lachenmann indes hat gerade beim 75-Jahr-Jubiläum der Donaueschinger Musiktage eine Rede gehalten, in der er, Nietzsche zitierend, lakonisch proklamierte: "Die Musik ist tot." Sie muß, als ob es sie gar nicht gebe, immer wieder neu zum Leben erweckt, wenn nicht gar erfunden werden. Wie nur wenige Komponisten hält er rigoros an der Idee einer Kunst fest, die permanent in statu nascendi zu sein habe, die sich auf keinerlei Traditionen oder gar Konventionen verläßt, die den allemal riskanten Kurs aufs offene Meer des je eigenen Ansatzes nicht nur nicht scheut, sondern mit Bedacht sucht. Konflikte sind ihm nicht erspart geblieben: Die Orchestermusiker haben gegen die angebliche "Unspielbarkeit" seiner Werke opponiert, die Neo-Konservativen haben sich an seiner vermeintlichen Kommunikationsfeindlichkeit gerieben, die Rechten den Nono-Bewunderer marxistischer Wühlarbeit geziehen, die Linken ihm seine Verweigerung gegenüber Agitprop-Rezepten nicht vergeben. Und die Cage-Adepten hielten ihn für einen unverbesserlichen Anhänger eines strikt seriellen Strukturalismus. Viel Feind, viel Ehr.
Lachenmann ist sich treu geblieben. Dreieinhalb Jahrzehnte hat er Askese gegenüber dem Theater und der Elektronik geübt, auch allen Versuchungen populistischer Crossover-Ästhetik widerstanden - ganz zu schweigen von den Sirenengesängen der neuerdings Tonalitätstrunkenen. Dabei hat seine Musik immer wieder etwas virtuell Szenisches: Der Begriff einer musique instrumentale concrète hat bei ihm eine entscheidende Rolle gespielt - im Sinne eines "Komponieren heißt: ein Instrument bauen". Denn nicht nur die Musik, auch die Instrumente, ja das Orchester bedürfen der Neuschöpfung, und die Entstehung des Klanges selber muß zum Prozeß werden, in dem das Geräuschhafte nicht selten wichtigerist als der aus ihm hervorgehende "schöne" Ton. Darin hat Lachenmanns Musik ihr Haptisches, körperhaft Aufgerauhtes, mitunter auch physisch Attackierendes: akustische Mikro-Szenarien. Die Vorstellung einer theatralischen Großform mit klar abgesetzten, gar kantablen Singstimmen und "begleitendem" Instrumentarium ist ihm fremd. Insofern ist er Anti-Opernkomponist par excellence.
Hans Werner Henze ist hierin Lachenmanns Antipode, mediterran orientiert, mit einem mittlerweile schier unüberschaubaren, komplex-opulenten OEuvre, nicht zuletzt für Oper, Ballett und Film, überdies ein Mann des Metropolen- und Festivalglanzes. Förmlich als Antagonisten, womöglich gar als feindliche Brüder, gehören sie zusammen, sind denn auch schon heftig aneinandergeraten; es ist kein Zufall, daß parallel die Autobiographie des siebzigjährigen Henze wie die Schriften des sechzigjährigen Lachenmann erschienen sind. Denn beiden gemeinsam ist die Aversion gegen eine fatales Goethe-Diktum: "Bilde Künstler, rede nicht", das Lob auf den begriffslos einfach vor sich hin Werkelnden. Schumann, Berlioz, Liszt, Wagner, Busoni, Pfitzner, Debussy, Schönberg, Eisler, Krenek, Boulez, Stockhausen, Schnebel und Rihm - sie alle haben konsequent ästhetische Produktion und Reflexion als zusammengehörig betrachtet.
Das Notenschreiben und die Schriftstellerei als wechselseitige Meta-Ebenen: Für Lachenmann ist das Nachdenken über Musik eben nicht kunstfeindliches Zerdenken einer als "heil" vorgegaukelten Tonkunst, sondern genau umgekehrt: "Denn Hören ist wehrlos ohne Denken." Lachenmanns Vorträge und Aufsätze reichen keimhaft bis 1959 zurück, bis in die ersten Formulierungshilfen für seinen Lehrer Nono. Und nicht wenige Texte erweisen sich als dialektische Gratwanderungen zwischen Selbstvergewisserung und nicht minder dringlichem Selbstzweifel. Lachenmann bezieht Position, auch polemisch, doch läßt er sich immer wieder in die Komplexität einer Situation ein. Er macht es sich nicht leicht, glaubt, ähnlich wie der von ihm bewunderte Adorno, daß eine Problembewegung nicht einfach durch einen scheinsouverän gesetzten Punkt abzuschließen ist.
Als Verfechter einer alles andere als volkstümlichen Ästhetik instrumental-experimenteller Grenzüberschreitung zum Spröden, mitunter sogar "Häßlichen" hin hat er sich von manchen Linken den Vorwurf des Hermetisch-Elitären gefallen lassen müssen - obwohl er selbst als Linker heftig gegen das bundesrepublikanische Establishment Stellung bezog, nicht zuletzt im Zeichen Nonos. Gleichwohl hat er darauf hingewiesen, daß das Vertrauen etwa auf die Wirksamkeit Hanns Eislerscher Kampflieder-Modelle deren gesellschaftliche Vereinnehmbarkeit verkenne. Einer Avantgarde ohne gesellschaftliches Engagement werde ebenso die Spitze gebrochen wie einer Politkunst ohne äußerste immanent kompositorische Fortschrittlichkeit.
Im Gegensatz zu Adorno, Eisler und Benjamin, auch Bloch oder Georg Lukács kommt Lachenmann nicht aus einem hegelianischen Marxismus und jüdischer Tradition, sondern - wie nicht wenige radikale Gesellschaftsveränderer - aus einem schwäbischen Pastorenhaus. Man sollte derlei biographische Zusammenhänge nicht, wie heute gerne üblich, fetischisieren; doch Lachenmanns ästhetisch-moralischer Rigorismus, sein unbedingtes Wahrheitsstreben, sein Paktieren nicht mit Macht und Herrlichkeit, sondern mit ungeschütztem Leid, wovon "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" so anrührend zeugt, haben eine protestantische Komponente. Und keineswegs zufällig gedenkt er mit Sympathie und Respekt, weit über alle Konvention hinaus, einer anderen Stuttgarter Pastorentochter, des RAF-Mitglieds Gudrun Ensslin.
Lachenmanns minutiöse Analysen eigener und fremder Werke, die Darstellung seiner Kompositionsverfahren, die verschiedenen Hommages an Nono, die Auseinandersetzungen um "politische Musik" wie mit den Neo-Tonalen, aber auch - noch im Banne Nonos - mit der "Unbestimmtheits-Ästhetik" John Cages sind immer noch fesselnde Protokolle eines weitreichenden, nicht nur immanent musikalischen Diskurses. Natürlich hat sich auch Lachenmann gewandelt, in den achtziger Jahren gemeinsam mit Nono begriffen, daß es geheime Verbindungslinien zwischen diesem und Cage gab - ohne daß Lachenmann je in Versuchung geraten wäre, seinem eigenen Komponieren den Stachel sperrigster Distinktheit zu nehmen. So wie er es auch unternommen hat, in Analogie zu einem Bach-Essay Adornos, Gustav Mahler gegen seine Liebhaber zu verteidigen, ihn vor einer wohlfeil-kulinarischen Vereinnahmung zu bewahren.
Bei einer öffentlichen Diskussion in Stuttgart war es zum heftigen, auch persönlich scharf geführten Disput zwischen Henze und Lachenmann gekommen. Henze hat auf ihn im Arbeitstagebuch zur "Englischen Katze" noch einmal polemisch Bezug genommen. Lachenmann hat in einem Offenen Brief repliziert. Zieh Henze Lachenmann der sterilen, traditions- wie letztlich darin auch menschenfeindlichen Avantgarde-Hermetik, so bescheinigte Lachenmann Henze Anbiederung an bürgerliche Hörgewohnheiten, der Kumpanei mit einem eben nicht nur künstlerischen juste milieu. Lachenmann machte in dem Streit die bessere, intellektuell differenziertere Figur. Gleichwohl haben Henze und Lachenmann wieder zum kooperativen Kontakt miteinander gefunden. Überhaupt bedeutet es nicht im mindesten ein kompromißlerisches Wischiwaschi, gestattet man sich den Zweifel am "recht haben". Denn weder ist Henzes Ästhetik so unscharf noch die Lachenmanns so ehern, daß nicht Berührungspunkte zumindest denkbar wären. Berührungsängste haben wohl beide: Henzes Darmstadt-Trauma entspricht die Opern-Phobie Lachenmanns. Wechselseitige Abwehr, womöglich also auch uneingestandene Affinität mag immerhin im Spiel sein. Voneinander lassen werden Henze wie Lachenmann, samt ihren Anhängern, wohl kaum. Denn im Januar wird nicht nur Lachenmanns erstes Musiktheaterwerk, sondern auch Henzes bislang letzte Oper, "Venus und Adonis", in München uraufgeführt. Der Diskurs über den möglichen wahren Weg wird weitergehen.
Josef Häusler hat Lachenmanns Schriften von 1966 bis 1995 herausgegeben und mit einem Vorwort und Anmerkungen versehen - eine ganz vorzügliche Edition. Der thematische und stilistische Fächer ist weit, umfaßt detaillierte Analysen, Komponistenhuldigungen, Grundsätzliches zu Politik und Kulturpolitik - und immer wieder zum Dilemma heutiger Ästhetik, weit über die Musik hinaus.
Helmut Lachenmann: "Musik als existentielle Erfahrung". Schriften 1966-1995. Herausgegeben von Josef Häusler. Insel-Verlag, Frankfurt 1996. 454 S., geb., 98,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main