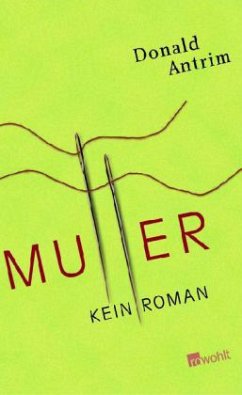An einem schönen Augustmorgen des Jahres 2000 entschläft Donald Antrims Mutter Louanne nach langem Krebsleiden im Morphiumrausch. Was macht ihr Sohn, kaum dass sie unter der Erde ist? Er kauft sich ein Bett. Und zwar nicht irgendeines, sondern ein nach den neuesten Erkenntnissen esoterisch-biotechnischer Schlafforschung gestaltetes, sündhaft teures Monster. Dieses Bett soll seine Befreiung feiern; es soll sein Fluchtort werden. Aber er tut nie ein Auge darin zu."Mutter" ist ein erschreckend klarsichtiges Buch. Antrim beschreibt sein Leben in einer durchgedrehten Alkoholikerfamilie: das komplexe Wechselspiel von Macht und Furcht, Manipulation und Widerstand, der immer auf ein Mirakel hofft, auf ein Ereignis, das alles verändert und ihn wie ein großes Kunstwerk der Erlösung näher bringt. Dies alles erfasst Antrim in einem Reigen von Geschichten, die sich um- und ineinanderwinden: minuziöse Momentaufnahmen, präzise, sinnlich und voller Ironie. Und er schafft damit - große Literatur.

Muttersterben: Donald Antrim wird autobiographisch
Blaubeerpfannkuchen oder die berühmten Eier "Benedict"? Oft sind gerade die trivialsten Fragen am schwersten zu entscheiden - wie die Wahl im Restaurant, vor der der Erzähler in "The Verificationist", Donald Antrims letztem Roman, kapitulieren muß. "Die Wahl zwischen Banalitäten ist eine der bedrückenderen Plagen im Leben. Wir alle wissen, daß die einfachsten Dilemmata über symbolische und emotionale Pfade im Unbewußten zu größeren, häufig schmerzhaften Problemen führen können", so die Selbstdiagnose des professionellen Psychoanalytikers, der beim lockeren After-Work-Meeting seiner lokalen Zunftgenossen über dem Studium der Speisekarte eine Krise kriegt: Blaubeeren? Blau oder nichtblau, das ist hier die Frage, auch in der scheinbar harmlosen Diskussion mit seiner Ehefrau über den Anstrich eines leerstehenden Zimmers. Hinter der Farbwahl der Partnerin vermutet der Seelenforscher den geheimen Kinderwunsch - "das ungestrichene Zimmer als Stätte unausgesprochener Gedanken, symbolisches Zuhause und Spielzimmer ungeborener Generationen, die an unsere Stelle treten und uns schließlich beerdigen werden, wenn wir, uralt, klapprig und delirierend, sterben". Also dann eben her mit diesen Pfannkuchen, verdammt noch mal!
Nun also ein Bett. Im ersten Kapitel seines neuen Buchs erzählt der amerikanische Schriftsteller Donald Antrim von seinem Versuch, in den Tagen und Wochen nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2000 ein Bett zu kaufen. Oder besser, wie er gleich klarstellt, davon, wie er "ein Bett zu behalten versuchte". Denn er kauft nicht nur eines, sondern mehrere. Er kauft, nach ausgiebigem Probeliegen mit der Freundin, eins bei Bloomingdale (für zweitausend Dollar), storniert den Kauf, nimmt ein größeres und teureres (mit Matratzenauflage), storniert erneut (",Wie lange hält so ein Ding eigentlich? Hat der Typ das gesagt?' - ,Donald, nimm das Bett, bei dem du das beste Gefühl hast. Später kannst du immer noch andere Betten kaufen.' - ,Später? Wieso später? Später im Leben?'"), sucht weiter und liegt weiter Probe, kauft ein anderes: "Drei Monate vergingen, und in dieser Zeit erfuhr ich mehr, als ich je für möglich gehalten hatte, über Matratzen und über die Matratzenindustrie im allgemeinen - nicht nur, wie und wo die Betten hergestellt, sondern auch, wie sie vermarktet und verkauft werden und an wen - und dabei erfuhr ich auch eine Menge über andere Dinge als Betten im engeren Sinne. Ich spreche von Steppdecken, Kissen und Laken."
Mit diesem Bett hat es seine besondere Bewandtnis, soviel ist klar. Dieses Bett soll das Leben Antrims verändern, den ultimativen Neuanfang markieren, seine Schaffenskrise wegträumen, seine Beziehungsprobleme hinwegschnarchen, den ruhenden Sexualtrieb wecken, ein neues Buch im Schlaf schreiben. Antrims Mutter, zeitlebens eine schwere Raucherin, ist an Lungenkrebs gestorben, und der Autor ertappt sich bei "wahnhaften Gedanken" über sich und seine Beziehung zu ihr: "Endlich bin ich von dieser Frau befreit! Jetzt kaufe ich mir ein tolles Bett, vögle anständig und lebe mein Leben." Aber dieses Wunderbett hat auch noch eine andere, narrative Funktion. Das immer absurder werdende Eingangskapitel ist so etwas wie der erzählerische Federkern dieses Buchs; es dient auch dazu, mögliche Irritationen abzudämpfen, die es bei Antrims Lesern auslösen dürfte.
Denn "Mutter", im amerikanischen Original "The Afterlife", ist ein tiefernstes, schonungsloses und berührendes autobiographisches Werk, das zwar in seinem bitteren, fast masochistischen Sarkasmus an die früheren Werke Antrims erinnert, aber deren fiktionalen Wärmeschild absurder, ins Irreale umschlagender Komik völlig aufgibt und sich ganz ungeschützt dem Glutkern eines privaten Seelendramas nähert. "Kein Roman", glaubte der Rowohlt Verlag dem Buch, das im Original schlicht und ehrlich als "A Memoir" firmiert, aufdrücken und aufdrucken zu müssen: Besser hätte man es gleich mit Baudelaire "Un Coeur mis à nu" nennen können: Nichts weniger als ein nacktes, ein entblößtes Herz bekommen wir hier aufgetischt.
Die Dämonen des Alkohols
Antrim zieht eine schmerzhaft ehrliche Bilanz seines Verhältnisses zu dieser gleichermaßen gehaßten wie geliebten Frau, die als schwere Alkoholikerin wie eine Art "Jekyll and Hyde" seine Kindheit, Jugend und Adoleszenz - ja was eigentlich: prägte, bestimmte, verkorkste? Antrim ist sich wohl bewußt, daß hier jeder Ausdruck zu schwach ist. Ihre komplexe und widersprüchliche, zwar kranke, aber auch faszinierende Persönlichkeit ist ein nicht zu tilgender Teil seiner selbst: "Die Geschichte meines Lebens ist eng verknüpft mit dieser Geschichte, dieser Geschichte ihres Verfalls. Sie bestimmt von jeher maßgeblich die Art und Weise, wie ich mich und andere in der Welt wahrnehme. Sie - oder vielmehr meine Rolle darin - sorgt dafür, daß ich meine Mutter niemals verliere."
Auf vielen Umwegen und mit Antrims typischen, wie zufällig wirkenden, aber sorgfältig komponierten Retardierungen und Digressionen erfahren wir nach und nach die ganze traurige Lebens- und Leidensgeschichte von Louanne Antrim: ihre Jugend in Florida, die Ehe mit Donalds Vater, einem Literaturwissenschaftler, die never ending story ihrer Trennungen, Wiederversöhnungen, Umzüge, ihres rast- und ruhelosen Herumstreunens, ihrer furchtbaren Streitigkeiten, der für die Kinder ganz überraschenden Wiederverheiratung, der erneuten Trennung, die beinahe schon tödliche Alkoholkrankheit, die der Familie das Leben zur Hölle machte - und schließlich die unwahrscheinliche Neuerfindung der doch noch clean gewordenen, aber weiterhin wie ein Schlot rauchenden Mutter als Modekünstlerin und Esoterikerin.
Die Erzählstruktur folgt dabei immer einer Logik des Gedächtnisses, in der die Zeiten und Schauplätze (die Wohnungswechsel der Familie beziehungsweise ihrer Einzelteile sind kaum zu überblicken) munter abwechseln. Dabei will Antrim keinen experimentellen Text, eine amerikanische Variation etwa von Michel Leiris' "Spielregel" oder anderen Klassikern des Genres schreiben; immer wieder ruft er sich selbst zur narrativen Ordnung: "Doch zurück zur vorliegenden Geschichte" und "Aber was war nun mit dem Bett?"
Das erste Kapitel, die "Bettgeschichte", fungiert als Exposition, wobei der Sterbevorgang selbst, den Antrim in seiner letzten Phase im mütterlichen Haus begleitet, denkbar beiläufig erzählt wird: "und ich hielt meiner Mutter die Hand und sagte ihr, bis auf uns beide sei das Haus leer, nur sie und ich seien im Haus, draußen vor den Fenstern sei es ein schöner Tag, Vögel säßen in den Bäumen, ein leichter Wind bewege die Blätter, Wolken zögen über den Himmel, und wenn sie wolle, könne sie ruhig sterben, was sie prompt tat." Um die zarte Idyllik dieser Szene herum entwickelt Antrim ein Psychodrama Strindbergschen Ausmaßes, die Geschichte seiner Vernachlässigung durch die vom Dämon Alkohol zerrüttete Frau. Die hellsichtig benannten Paradoxien führen zu einer Umkehrung, so daß Antrim selbst Schuldgefühle als "Mörder" seiner Mutter empfindet - und so auch auf einem noch so luxuriösen Bett keine Seelenruhe finden kann.
Antrim bekommt seinen Stoff auf souveräne Weise in den Griff, indem er in sieben Kapiteln jeweils andere Details und Figuren scharfstellt: etwa die ebenso skurrile wie tragische Gestalt des Lieblingsonkels Eldridge, eines Lebenskünstlers und Eigenbrötlers, der dem Jugendlichen eine Flucht aus den zerrütteten Familienverhältnissen bot. Doch schließlich erscheint auch er als Parallelfigur zur Mutter: Mit zweiundfünfzig Jahren hat er sich zu Tode gesoffen. Weitere Teile legen den Fokus auf einen psychisch labilen Künstler und Exfreund der Mutter (der der fixen Idee nachhängt, einen verschollenen da Vinci entdeckt zu haben) oder den Vater, zu dem das Verhältnis trotz der gemeinsamen Liebe zur Literatur immer kühl und distanziert bleibt.
Ein ganzes Kapitel beschäftigt sich ausgiebig mit dem künstlerischen "Werk" seiner Mutter, das diese, nachdem sie Anfang der achtziger Jahre dem Alkohol (doch nicht dem Tabak) abgeschworen hatte und damit dem Tod gerade noch einmal von der Schippe gesprungen war, mit großem Ernst vorantrieb. Louanne Antrim, ausgebildet als Schneiderin und einst Textilwissenschaft lehrend, fertigte Kleider - keine normalen, sondern fast untragbare, unmögliche, mit allerlei symbolischem Krimskrams wie einem Christbaum behängte Gesamtkunstwerke, mit denen die einst einnehmende und gesellige, dann zunehmend vereinsamende Frau sich auch äußerlich in einen versponnenen New-Age-Kosmos verabschiedete.
Bastarde aus Wahn und Welt
Die Beschreibung und psychologische Deutung dieser zur Berufung verklärten Obsession ist ein Höhepunkt des Buchs. Wer mit Antrims Werk vertraut ist, ahnt, daß der Sohn in diesen grotesken Kreationen auch Spiegelbilder erblickt. Antrims drei Romane nämlich mögen auf den Leser einen ähnlichen Eindruck machen: "Die Beschießung des botanischen Gartens" (1993, deutsch 1999 bei Edition Epoca) ist das satirische Porträt einer Ostküstenkleinstadt, in der die Nachbarn sich mit Stinger-Raketen bekriegen. "The Hundred Brothers" (1998, noch nicht übersetzt) erzählt von den Rivalitäten und Konflikten eben genau dieser Hundertschaft, die sich zwecks Verstreuung der Asche ihres Erzeugers zum Dinner versammelt. Und das unter dem dämlichen Titel "Ein Ego kommt selten allein" 2001 bei Residenz veröffentlichte, herrlich komische "The Verificationist" gipfelt in der Vision des unter der Decke schwebenden und auf seine Kollegen und deren Gruppendynamik herabblickenden Analytikers.
Drei sich an Seltsamkeit gegenseitig übertrumpfende Bücher also, die auf unterschiedliche Weise die Fesseln des erzählerischen Realismus sprengen und die neben gängigen big American novels (etwa von Antrims engem Freund Jonathan Franzen) wie kleine, böse Bastarde aus Wahn und Wirklichkeit daherkommen. Diese sehr eigenwillige Poetik der Phantasmagorie, in der psychische Realitäten, Tagträume und Wünsche wie Fakten behandelt werden, erweist sich im Selbstversuch als überaus produktiv. Doch kann man umgekehrt "Mutter" auch als Porträt des Künstlers als junger Mann lesen: Die Konfrontation mit den Delirien und Hirngespinsten seiner Alkoholikersippe hat Antrim als Autor zu seinem erzählerischen Programm geführt, das eine Spielart der amerikanischen Gegenwartsliteratur ist, in der das Sardonische und Gemeine einmal über die ewigen happy endings siegen darf.
In den vergangenen Jahren sind in Deutschland einige Bücher erschienen, in denen Autoren das Sterben ihrer Mütter zum Anlaß peinlich genauer Selbstbefragung nehmen: Karl-Heinz Otts schöner Erstling "Ins Offene" oder Jakob Heins "Vielleicht ist es sogar schön", Michael Lentz' furiose Prosa "Muttersterben" und, zuletzt, "Die Ruhe" des Ungarn Attila Bartis. Daß alle diese sehr unterschiedlichen Bücher Anklage und Hommage zugleich sind, Bilanz und offene Rechnung, Schlußstrich und work in progress, liegt in der Natur der Sache. "Ambivalenz" ist das Zauberwort, das nicht immer so dramatische Umstände wie bei Antrim braucht, um in einem Wechselbad von Gefühlen zwischen Haß und Liebe hervorzutreten.
"Mutter" endet mit einer Episode, in der der Sohn einmal, durch seine schnelle Heimreise, der im Delirium tremens versinkenden Mutter das Leben rettete und sie wie ein Kind pflegt - ein anrührender Rollentausch, voller Zärtlichkeit und Intimität. Donald Antrims Buch, mit seiner bitteren Komik, seiner Intelligenz und seinem glasklaren, sezierenden Blick auf die Menschen und vor allem sich selbst, bewahrt das Leben eines nahen, eines geliebten und gehaßten Menschen in der Erzählung. Das ist nicht viel, fast nichts gegen eine wirkliche Lebensrettung. Aber es ist das Höchste, was Literatur erreichen kann.
Donald Antrim: "Mutter". Kein Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingl. Rowohlt Verlag, Reinbek 2006. 240 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Mit erstaunlicher Leichtigkeit gelinge es Donald Antrim, von den schwer belasteten Familienbeziehungen seiner Kindheit zu erzählen, vor allem aber vom tragischen Schicksal seiner Mutter. Rezensentin Angela Schader lobt ausdrücklich, dass der Roman keinesfalls nur um eine Mutter-Sohn Geschichte kreise, sondern "verstörende" Porträts beispielsweise auch des Onkels zeichne, und überhaupt das Gewebe der Familienbeziehungen beschreibe. Dabei gehe der Autor äußerst feinfühlig vor, gewissermaßen ohne seinen Figuren zu nahe zu treten. In seiner erzählerischen Struktur werde der Roman durch heftige Kontraste und Inszenierungen, willkürliche Wechsel bestimmt. Den Kontrast wiederum zu diesen harten Schnitten und dem überspannten Familienleben bilden beschreibende und reflektierende Passagen über Gemälde oder Häuser, von denen laut Rezensentin eine Art "inneres Leuchten" ausgeht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Donald Antrims Buch, mit seiner bitteren Komik, seiner Intelligenz und seinem glasklaren, sezierenden Blick auf die Menschen und vor allem sich selbst, bewahrt das Leben eines nahen, eines geliebten und gehassten Menschen in der Erzählung. Das ist ... das Höchste, was Literatur erreichen kann. Ein tiefernstes, schonungsloses und berührendes Werk. FAZ.NET