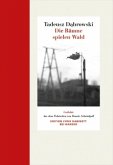Vlavianos, griechischer Dichter und kosmopolitischer Poet, ist in vielen Sprachen und Kulturen zu Hause: die Jugend in Südamerika und Italien, die Studienjahre in England, das Leben auf Reisen. Die gesammelte Erfahrung dieser Jahre spiegelt sich auch in seinen Gedichten. Und er ist ein Dichter, der das bedeutende Erbe der griechischen Poesie von den frühen Anfängen in der Antike in unsere heutige Zeit überführt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Haris Vlavianos philosophiert mit gepresster Stimme
In der Edition Lyrik Kabinett des Hanser Verlages sind die Gedichte von Haris Vlavianos erschienen. Der optisch wie haptisch reizvoll gestaltete Band enthält eine Zusammenstellung aus den bisher zum Großteil nur auf Griechisch publizierten Gedichtbüchern des 1957 in Rom geborenen Lyrikers und Universitätsprofessors. Es ist ausgesprochene Gedankenlyrik. Wie offenliegende Rohrsysteme ranken sich die Denkbewegungen um- und ineinander und ergeben ein sprödes Konstrukt.
In seinem kurzen, erhellenden Nachwort spricht Joachim Sartorius von den literarischen Einflüssen: T. S. Eliot, Ezra Pound, John Ashbery, Ted Hughes und wie sie alle heißen. Dieser Verweis wäre eher nichtssagend, würde er nicht durch die Tatsache unterstützt, dass Vlavianos viele dieser Autoren ins Griechische übertragen hat. Man mag nun Geistesverwandtschaften vermuten, Spurenelemente der Übersetzten, die sich am Übersetzer angelagert haben; doch man findet nichts, jedenfalls nichts Handfestes. Die intertextuellen Vexier- und Lustspiele bleiben aus, der Dialog mit den Vorläufern wird verschwiegen.
Nun kann man Gedichten schlecht vorwerfen, dass sie sich nicht immer und ständig auf andere Gedichte anderer Autoren beziehen. Ein anderer Vorwurf wiegt schwerer, und Vlavianos muss ihn sich, wie fast jeder Lyriker, der sich auf das dünne Eis der philosophischen Gedichte begibt, gefallen lassen: Allzu oft gewinnt das Traktathafte die Oberhand nicht nur über das dichterische Bild, sondern auch über die Klarheit und Originalität der Gedanken. "Die Geschichte erteilt keinen Unterricht in gutem Benehmen. / Die Notwendigkeit des Handelns / kann das Bewußtsein nicht ersetzen." Hier zeigt sich, dass ein Gemeinplatz noch keinen Vers macht, wobei man die Überzeugung, mit der solche Sentenzen hervorgebracht werden, bisweilen sogar rührend finden kann.
Lockeres Parlando verschmilzt hier mit Aussagesätzen, die oftmals wirken, als entstammten sie einem philosophischen Grundlagenwerk. Die verschiedenen Tonlagen wollen jedoch nicht so recht zusammenpassen. Wo das eine als Ergänzung des anderen gedacht ist, als ein Versuch der Ausleuchtung der Erscheinungswelt mit Hilfe eines ideellen Apparats, findet in den meisten Fällen nur eine Überlagerung statt, in der "die Anrufungen von Musen und Engeln" zwar "einen Ton von Natürlichkeit bewahren" wollen, unter der Last des Überbaus aber nur als hoffnungsvoll gepresste Stimmen vernehmbar sind.
Gewissermaßen handelt es sich bei dieser Lyrik um eine sehr enge, eingeengte Lyrik. Wie groß die Räume auch sein mögen, die sie öffnet - die Weite kippt augenblicklich in den nachschiebenden Gedankenstrom zurück und wird dort bis zur Unsichtbarkeit eingekocht. Nichts darf unkommentiert bleiben, jede Erscheinung muss mindestens doppelt gefasst und abgewogen werden. Dass es dem lyrischen Ich bei Vlaviano angesichts einer archivierten Welt weniger um die Haltbarmachung von Zuständen geht als vielmehr um des Sprechen über diese Zustände, zeigt sich in der Frage "und kann in einer Zeit fanatischen Dokumentierens / denn ein Vers die Trauer eines Menschen fassen / der nichts mehr zu sagen hat / und weiterspricht / weil er weitersprechen muss?" So fließt das dahin, weniger sprachkritisch, als man es sich wünschen möchte.
LARS REYER
Haris Vlavianos: "Nach dem Ende der Schönheit". Gedichte. Hanser Verlag, München 2007. Aus dem Griechischen übersetzt von Torsten Israel. 87 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Lars Reyer hat sich mit den Gedichten des in Rom geborenen und überwiegend auf Griechisch publizierenden Lyrikers Charis Vlavianos ziemlich schwer getan und das, obwohl er zunächst die schöne Aufmachung des Bandes mit einer Auswahl aus Vlavianos' bisher erschienen Gedichtbänden lobt. Der Rezensent charakterisiert das Werk des Lyrikers als ausgesprochene "Gedankenlyrik", und damit zeichnet sich bereits ab, was Reyer am meisten stört. Den Gedichten hafte etwas "Traktathaftes" an, das die lyrischen Bilder überdecke, jedem Einfall auch gleich einen Kommentar oder einen Nachgedanken hinterherschicke und überhaupt etwas "Sprödes" habe, moniert der Rezensent. Mitunter etwas unklar mischt Vlavianos einen lockeren Plauderton mit "Aussagesätzen", die sich nicht harmonisch zusammenfügen, so Reyer unzufrieden, der sich weniger rigide und "einengende" Verse gewünscht hätte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Was diese Gedichte im Innersten zusammenhält, ist Vlavianos´ Glaube an das Primat des Künstlers und die Kraft der Dichtung." Joachim Sartorius